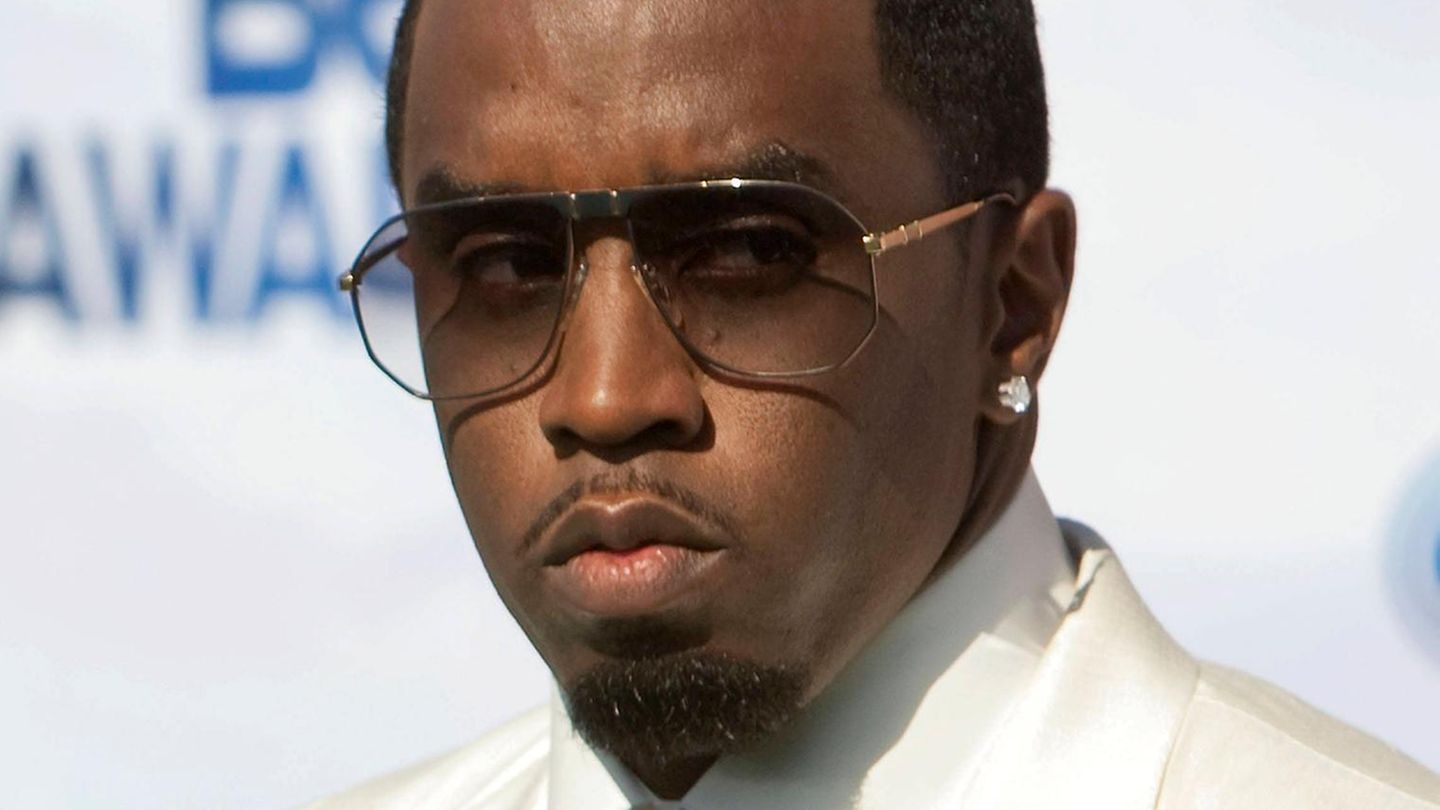Donald Trump schwingt den Zollhammer gegen fast die ganze Welt, holt ihn dann größtenteils wieder ein und kämpft stattdessen mit massiven Zöllen gegen China. Doch die "wirtschaftliche Kanonenbootpolitik" des US-Präsidenten stammt aus einer anderen Zeit.
Donald Trump und das Zollchaos bestimmen die Weltpolitik. Anfang des Monats verkündet der US-Präsident am selbst ausgerufenen "Liberation Day" Zölle für fast die ganze Welt. Unter anderem die Europäische Union reagiert mit Gegenzöllen auf die Politik aus Washington. Am vergangenen Mittwoch in dieser Woche setzt Trump den Großteil der Zölle dann für 90 Tage aus, Brüssel zieht auch zurück. Der Zollstreit mit China hat dagegen längst die nächste Eskalationsstufe erreicht. Die Aufschläge für Waren aus China liegen inzwischen bei 145 Prozent, umgekehrt hat Peking die Zölle für US-Produkte auf 125 Prozent erhöht.
Was bezweckt Trump mit diesem Chaos? "Ohne Zweifel sind Zölle ein Teil von Donald Trumps Weltbild", sagt US-Korrespondent Peter Kleim. "Donald Trump träumt vom 'Gilded Age', der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hier in den USA. Damals finanzierte sich der Staat primär aus Zöllen, Einkommensteuer gab es damals noch nicht."
Donald Trump ist ein wirtschaftspolitischer Nostalgiker. Das "Gilded Age," zu Deutsch "Vergoldetes Zeitalter", war geprägt von einem rasanten Wirtschaftswachstum, Industrialisierung und Urbanisierung. Etliche neue Fabriken entstanden in dieser Zeit, Menschen zogen vom Land aus in die Städte, um in den neuen Fabriken zu arbeiten. Doch dann kam der Erste Weltkrieg, das "Vergoldete Zeitalter" kam nicht mehr zurück. 1929 crashte die New Yorker Börse am "Schwarzen Freitag", die USA steckten in einer schweren Wirtschaftskrise und 1930 wurde in Washington der Zollhammer geschwungen. Der damalige Präsident Herbert Hoover, ein Republikaner, unterschrieb den Smoot-Hawley Tariff Act, ein nach zwei republikanischen Kongressabgeordneten benanntes Zollgesetz.
95 Jahre nach Zoll-Hammer: "Völlig andere Bedingungen"
Nie zuvor waren die Durchschnittszölle der USA auf ausländische Waren höher als damals. Bis jetzt, als Donald Trump am "Liberation Day" den Zollhammer ausgepackt hat. 1930 hatte Hoover die Zölle eingeführt, um die eigene Industrie und die amerikanische Landwirtschaft zu schützen. Aber die Bedingungen sind fast 100 Jahre später vollkommen andere. "Damals hatte die Große Depression bereits begonnen, die Weltwirtschaftskrise war in vollem Gange und es gab bereits hohe Importzölle", berichtet Roland Peters, US-Korrespondent von ntv.de, im Podcast "Wieder was gelernt".
Mit dem Smoot-Hawley Tariff Act schossen die Zölle weiter in die Höhe. Trump habe dagegen eine "brummende US-Wirtschaft" von Joe Biden übernommen und die Zölle "ohne Not eingeführt", analysiert Peters im ntv-Podcast. "Trump will der Welt offenbar eine kleine handelspolitische Zeitenwende aufzwingen. Er setzt Zölle als Druckmittel ein, propagiert sie als Einnahmequelle für den Staat, weil Zölle für die anderen, das klingt natürlich viel besser als Steuern für die eigenen Bürger. Aber das sind die Zölle im Endeffekt."
Donald Trump will die amerikanische Industrie schützen und stärken. In den Vereinigten Staaten sollen wieder "blühende Hauptstraßen und Heimatstädte für amerikanische Arbeiter entstehen, die amerikanische Produkte herstellen und diese an die amerikanische Öffentlichkeit verkaufen", beschreibt das Wall Street Journal die Vision von Donald Trump.
Darüber hinaus versucht der US-Präsident eigenen Angaben zufolge, ausländische Firmen in die Vereinigten Staaten zu locken. Wer in den USA produziert, umgeht schließlich die Zölle. Trump setzt den Unternehmen damit die Pistole auf die Brust: Entweder ihr produziert in den USA und schafft Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten, oder eure Marktanteile werden kleiner, weil die Zölle eure ausländischen Produkte teurer machen und weniger Leute sie kaufen.
"Wirtschaftliche Kanonenbootpolitik"
Der Zollhammer von 1930 wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder eingepackt. Damals stellten die Amerikaner ihre Handelspolitik auf den Kopf, schafften Zölle weitgehend ab und finanzierten den Staatsapparat maßgeblich über die erst 1913 eingeführte Einkommensteuer. In der "Vergoldeten Zeit", von der Trump träumt, gab es noch keine Einkommensteuer. "Damals beuteten die sogenannten 'Räuberbarone' wie Mike Rockefeller oder Cornelius Vanderbilt ohne jegliche Regulierungen das Land aus, heutzutage macht Donald Trump den Regulierungsbehörden in Sachen Umwelt- und Verbraucherschutz den Garaus", zieht Kleim einen historischen Vergleich.
Nach der Unabhängigkeit von der englischen Krone sollten die Zölle die heimische Wirtschaft vor allem vor der mächtigen Industriemacht Großbritannien schützen. Später wurden die Zölle auch mit der nationalen Sicherheit begründet. Die USA stellten sich die Frage, wie sie sich im Ernstfall gegen einen militärischen Aggressor verteidigen könnten, wenn die eigene Waffenproduktion von Zulieferern im Ausland abhängig ist.
Trump nutzt ein Jahrhundert später ein ähnliches Argument, wenn es zum Beispiel um die Herstellung von Mikrochips geht. Diese werden größtenteils in Taiwan und China produziert und von dort in die Welt verschickt. Trump will die heimische Chipindustrie stärken, um nicht vom geopolitischen Hauptgegner China abhängig zu sein. "Das ist strukturelle Industriepolitik mit dem Hammer, wie sie die westliche Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat. Trump versucht, ausländische Firmen und Staaten in den Dienst der USA zu zwingen", analysiert Peters im Podcast. "Das ist wirtschaftliche Kanonenbootpolitik, die gar nicht in die vergangenen Jahrzehnte passt, in denen die USA als Verfechter des Freihandels aufgetreten sind."
Hohe Zölle auf Billigprodukte aus China
Auch die chinesischen Super-Billig-Anbieter wie Temu und Shein sind Donald Trump ein Dorn im Auge. Im Zuge des Zollchaos hat der US-Präsident ein Schlupfloch geschlossen, von dem vorrangig die chinesischen Billigshops profitiert haben: Die sogenannte De-Minimis-Regel besagte seit der Obama-Präsidentschaft, dass Waren bis zu einem Wert von 800 Dollar zollfrei in die USA importiert werden dürfen. Seit Februar fallen 30 Prozent Zollaufschlag an. Ab dem 2. Mai soll der Aufschlag auf 90 Prozent steigen, ab Juni sieht Trumps Plan sogar 150 Prozent Zoll vor.
Abgesehen von den amerikanischen Schnäppchenjägern, die bei Temu, Shein und Co bestellen, dürften die Folgen des Zollhammers für einen Großteil der amerikanischen Gesellschaft spürbar werden. "Wenn ich hier einkaufen gehe, kommt fast alles aus dem Ausland. Fast alle Experten gehen davon aus, dass die Preise für Verbraucher steigen werden. Das bedeutet Inflation", macht Peters deutlich.
"Geht bei Republikanern um Durchhaltevermögen"
Produktionskapazitäten im großen Stil aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten zurückzuholen, das geht auch nicht von heute auf morgen. Und auch wenn es klappt, könnte das die Verbraucherpreise nochmals nach oben treiben, weil die Lohnkosten in den USA höher sind als in Mexiko, China, Indien und Co. US-Handelsminister Howard Lutnick geht davon aus, dass dieser Effekt durch ein deutliches Plus an Automatisierung, dank des verstärkten Einsatzes von Robotern, aufgehoben wird.
Die meisten Experten rechnen aber damit, dass Trumps Kurs - wenn überhaupt - erst in vielen Jahren Erfolg haben könnte. Auch in den Vereinigten Staaten mangelt es an Fachkräften. In der herstellenden Industrie finden etliche Firmen schon jetzt keine neuen Mitarbeiter. Das alles kann kurzfristig wohl kaum durch Automatisierung aufgefangen werden.
Trumps zweite Amtszeit hat gerade erst angefangen, seine Amtsperiode dürfte aber nicht ausreichen, um die gesamte US-Wirtschaft umzustellen. "Es geht bei den Republikanern jetzt um Durchhaltevermögen. Im Kongress sind die Mehrheiten relativ dünn", macht Peters im ntv-Podcast deutlich. "Kann Trump die Kaufkraft der Menschen erhalten? Kommen Arbeitsplätze schnell und im großen Stil zurück? Und aus Sicht der Wirtschaft: Warum sollte sich überhaupt noch jemand darauf verlassen, dass sich die Bedingungen nicht wieder ganz plötzlich ändern?", verweist der US-Korrespondent auf das Zoll-Hickhack der vergangenen zwei Wochen.
Die Zollpolitik von vor gut 100 Jahren befeuerte die Große Depression, die Weltwirtschaftskrise in den 1930 Jahren, zusätzlich. Donald Trump sollte sich wohl kein Beispiel an Herbert Hoover nehmen.
"Wieder was gelernt" ist ein Podcast für Neugierige: Welche Region schickt nur Verlierer in den Bundestag? Wann werden die deutschen Strompreise sinken? Welche Ansprüche haben Donald Trump und die USA auf Grönland? Welche europäische Landwirtschafts-Bastion trocknet aus? Hören Sie rein und werden Sie dreimal die Woche ein wenig schlauer.
Alle Folgen finden Sie in der ntv App, bei RTL+, Amazon Music, Apple Podcasts und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden.
Sie haben eine Frage? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts@ntv.de