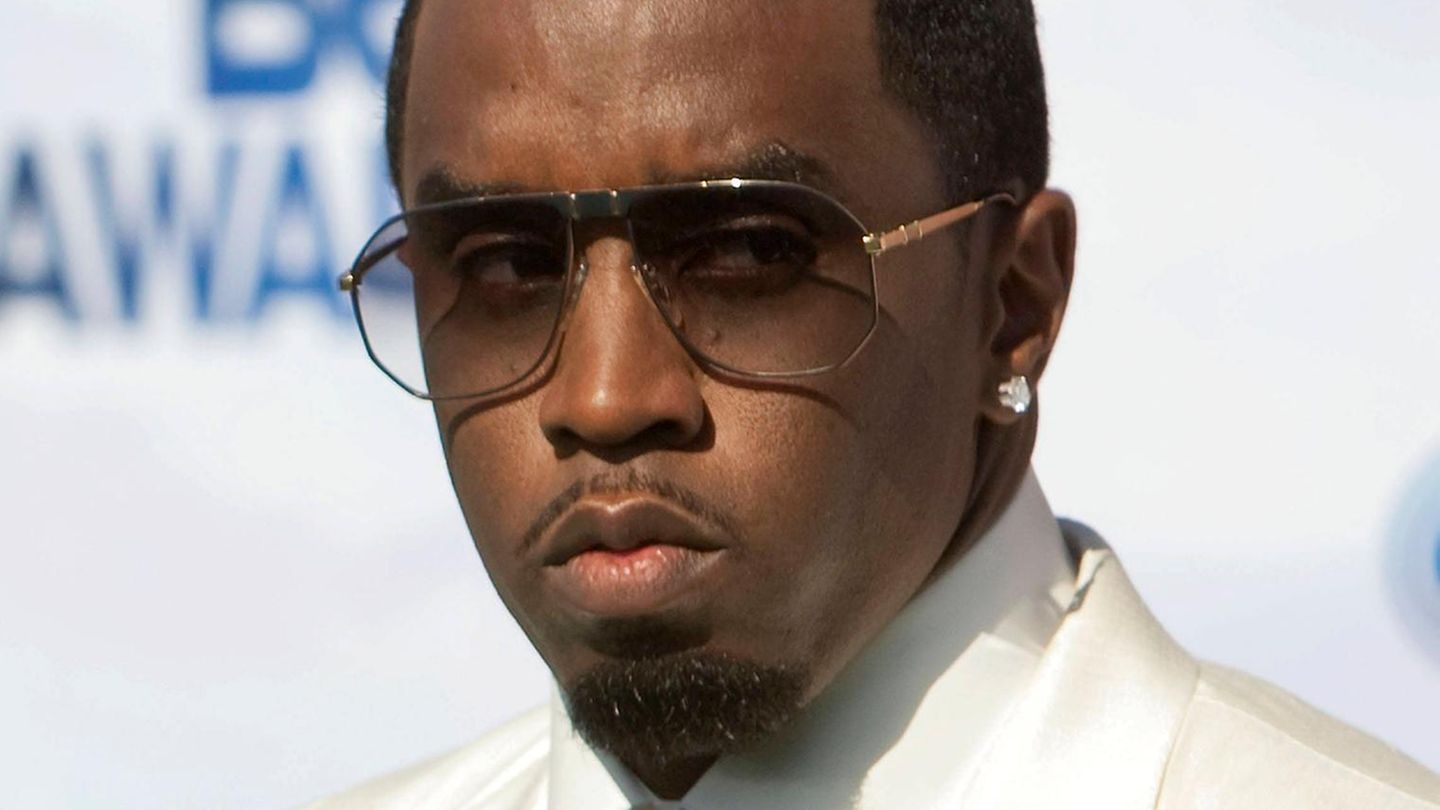Die Bundeswehr möchte nicht länger abhängig sein von US-Satelliten. Doch kann Deutschland schnell ein eigenes Satellitensystem aufbauen? Ein Experte zweifelt.
Nun wird Raumfahrt also auch in Deutschland endlich Ministeraufgabe, als Teil des Forschungsministeriums. Denn wer das All beherrscht, beherrscht auch die Erde. Das macht nicht zuletzt der Ukraine-Krieg deutlich. Ohne die Daten der Starlink-Satelliten von Elon Musk waren die Verteidiger auf dem Schlachtfeld zeitweise praktisch blind. Auch für die Zielerfassung sind die Koordinaten aus dem Weltraum unerlässlich.
Bis 2029 möchte die Bundeswehr nun eine eigene Satellitenkonstellation aufbauen, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Insider und die Bundeswehr berichtet. Besonders geeignet sind dafür sogenannte Multi-Satellitensysteme in niedrigen Erdumlaufbahnen. Dort haben die Funksignale eine geringere Verzögerung und die Kameras liefern eine höhere Auflösung. Allerdings benötigt man dazu mehrere Hundert Satelliten, um kontinuierlichen Kontakt zu gewährleisten.
Blindflug: Zwei Spionagesatelliten der Bundeswehr senden keine Signale
Klaus Schilling entwickelt seit über 20 Jahren in Würzburg Kleinsatelliten und hat als Vorstand des Zentrums für Telematik im letzten Jahrzehnt eine Kleinserienproduktion für Satelliten aufgebaut. Er ist skeptisch, was den genannten Zeitrahmen betrifft: "Derzeit produzieren die effektivsten europäischen Satellitenunternehmen gerade einmal rund sechs Satelliten pro Jahr." Bis 2029 kämen bei diesem "Rekordtempo" gerade einmal ein paar zwanzig Satelliten statt der nötigen Hunderten zusammen.
Auch die Technik für einen selbst-organisierenden Formationsflug so vieler Satelliten müsse noch weiterentwickelt werden, sagt Schilling. Diese benötigen eine hoch entwickelte Sensorik und Kontrolltechnik, um in den immer voller werdenden Umlaufbahnen Abstand zu halten, Kollisionen zu vermeiden und um gemeinsame Beobachtungen durchzuführen.
Auch an der notwendigen Kapazität, Hunderte Satelliten ins All zu bringen, fehlt es hierzulande noch. Zwar startete zuletzt das Münchner Unternehmen Isar Aerospace Ende März erstmals eine Rakete von einer norwegischen Abschussrampe aus. Aber schon nach nicht einmal einer Minute explodierte der Mini-Launcher und fiel ins Meer. Nicht viel besser erging es dem Mitbewerber Rocket Factory Augsburg (RFA). Vergangenes Jahr fing dessen Rakete noch auf der Startrampe in Schottland Feuer. Im Sommer will RFA nun einen neuen Versuch starten.
Bis Deutschland gar über einen eigenen Weltraumbahnhof verfügt, vergehen wohl mindestens noch fünf Jahre. Denn, um nicht über bevölkertes Gebiet zu fliegen, müssten die Raketen dann von einer Plattform in der Nordsee aus starten.
Satellitenflotte nur in Zusammenarbeit möglich
Bis dahin müsste Deutschland auf befreundete Länder wie Indien oder Japan zurückgreifen, die über funktionsfähige Raketen verfügen, um seine Satelliten ins All zu befördern. Oder die Großrakete Ariane 6 nutzen, die eigentlich für den Transport größerer Satelliten gedacht ist.
Falls die Bundeswehr tatsächlich eine eigene Satellitenformation aufbauen will, ist zudem fraglich, ob sich Deutschland weiter am Projekt Iris2 (sprich: Iris hoch zwei) beteiligen wird. Erst 2023 hatte das Europäische Parlament den Bau dieses europäischen Kommunikationssystems beschlossen, das von den Satelliten Elon Musks unabhängig machen soll.
Lange bevor Elon Musk den ersten Starlink-Satelliten ins All schoss, wurden in Würzburg Kleinsatelliten entwickelt. Doch eine Finanzierung für eine Serienfabrikation gab es in Deutschland lange Zeit nicht. Der technische Vorsprung war dann schnell dahin. Dennoch ist Schilling zuversichtlich, dass die heimische Industrie wieder zu der in den USA aufschließen und an dieser sogar vorbeiziehen könne: "Wir verfügen über moderne Satellitentechnik und sind führend in der Fertigungstechnik." Wenn sich die Firmen zusammentun und nicht jedes Unternehmen für sich agiert, könne es klappen mit der Satellitenflotte für die Bundeswehr.
Dass Weltraumtechnik immer noch Rocket Science ist, belegt der Bau von zwei Spionagesatelliten für die Bundeswehr. Sie flogen zwar 2023 wie geplant ins All, senden aber keine Daten zur Erde.

.png) 1 day ago
1 day ago