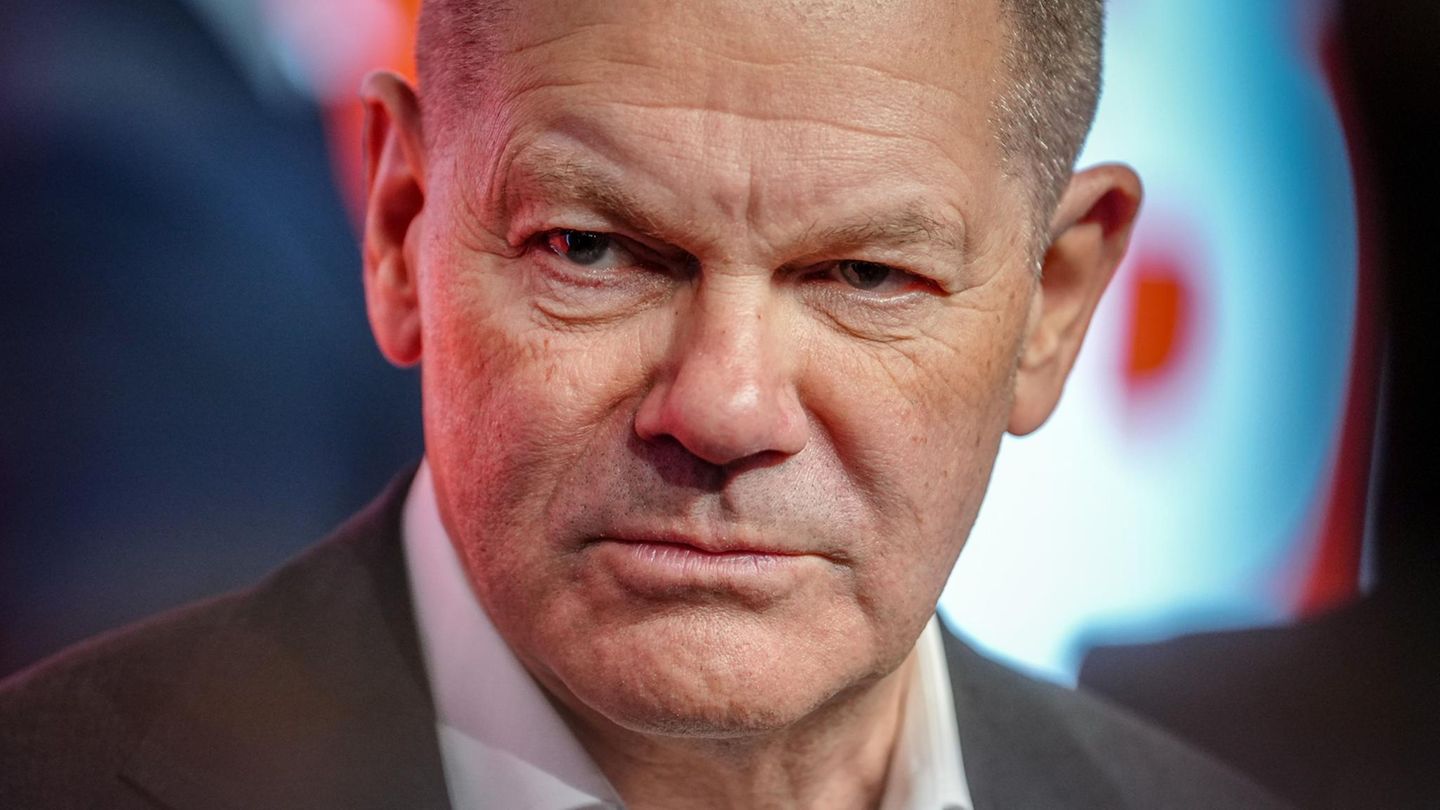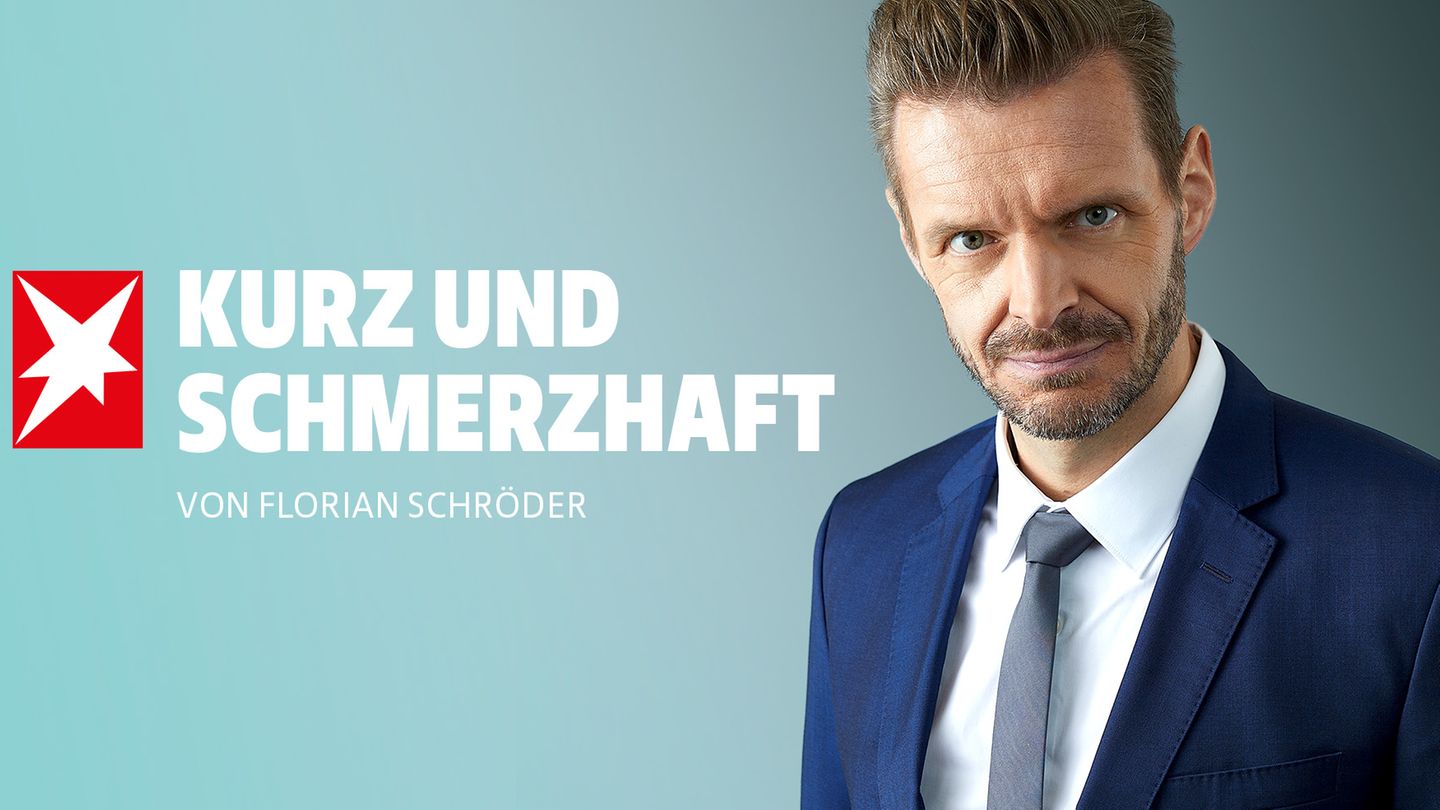An diesem Sonntag wird mal wieder das Erschrecken über das AfD-Ergebnis in Ostdeutschland groß sein. Doch es ist längst wieder viel mehr in Bewegung gekommen als nur das.
Ja, klar, noch sind es nur Umfragen. Doch wenn sich die Meinungsforschungsinstitute nicht vollständig irren, dann dürften am Abend des 23. Februars mindestens drei Dinge passieren.
Erstens wird Friedrich Merz als der nächste Kanzler feststehen. Zweitens wird seine Union mit Parteien, die nicht AfD, Linke oder BSW heißen, eher komplexe Sondierungsgespräche führen. Und drittens wird auf den Ergebniskarten wieder die alte Teilung Deutschlands präzise erkennbar sein – so, als habe nie eine Wiedervereinigung stattgefunden.
Die AfD gewinnt den Osten
Mit Ausnahme einiger Städte dürfte die AfD in Ostdeutschland sämtliche Direktmandate erringen und auch bei den Zweitstimmen der Wahlsieger sein. Damit werden die Konturen der untergegangenen DDR in hellem Blau leuchten, während sich die alte Bundesrepublik im Schwarz der Union mit SPD-roten Einsprengseln erhebt.
Ach so, und noch etwas ist vorhersehbar. Die Ostdeutschen, wird es wieder in verschiedenen Variationen heißen, seien nie in der westlichen Demokratie angekommen. Nur deshalb habe man nun den Salat – und die AfD mit 20 Prozent im Bundestag.
Das ist natürlich Unfug. Aber die Reflexe sind über verschiedene Wahlen eingeübt und sitzen entsprechend bequem – unbeschädigt durch die Tatsachen, dass die AfD eine im Westen gegründete Partei ist, die Westdeutsche dominieren und die auch diesmal wieder ihre Fraktionsstärke im Bundestag vor allem westdeutschen Wähler zu verdanken haben wird. Es gibt halt schlicht mehr davon.
Doch ich will, bevor ich es mit meinem Whataboutism zu weit treibe, eine nicht ganz so abgegriffene Erklärung dafür wagen, warum im einstigen Beitrittsgebiet die AfD doppelt so häufig gewählt wird wie in der alten Bundesrepublik. Und die geht so: Viele Ostdeutsche, die 1989 und 1990 bewusst erlebten, empfinden schon seit einer Weile ein Déjà-vu in Zeitlupe. Denn sie wissen aus sehr persönlicher, zuweilen existenzieller Erfahrung, wie sich ein Epochenwechsel anfühlt.
Es ist jetzt 35 Jahre her, dass die knapp 45-jährige Nachkriegsära endete. Damals gab es die Vorstellung, dass nun, nachdem der Kalte Krieg geendet hatte, ein Zeitalter von Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand angebrochen sei.
Ich war damals 18 Jahre alt und wollte nur zu gerne an etwas Neues glauben. Das DDR-System hatte mich, der Gnade der späten Geburt und meinen Eltern sei Dank, nur in Ansätzen korrumpieren können. Im Herbst 1989 hatte ich ein bisschen in Kirchen friedensgebetet und auf der Straße mitdemonstriert – und danach eilig mein Begrüßungsgeld abgeholt. Jetzt war ich bereit für das freie Leben und die große weite Welt.
Jenseits der Minderwertigkeitsgefühle, die mir bis heute hinterherschleichen, sah ich mich sogar als privilegiert an. Im Unterschied zu den Westdeutschen durfte ich mich trotz meines eingeschränkten Mutes der Projektion einer gemeinschaftlichen Selbstermächtigung zugehörig fühlen.
Und auch wenn ich nicht Helmut Kohls CDU wählte, sondern die versprengten Bürgerrechtler, hoffte ich doch insgeheim ebenfalls darauf, dass jetzt alles besser werden würde, mit der D-Mark und der Einheit und all dem anderen.
Für mich kam es auch so. Meine Eltern konnten sich beruflich verbessern und mein Studium finanzieren. Ich reiste viel, gründete eine Familie und wurde das, was ich in der DDR nie hätte werden können, ein Journalist, der diese Bezeichnung auch verdiente.
Der Westen schaute 1989 vor allem zu
Doch gerade weil ich diesen Beruf wählte, sah ich auch die Menschen, die viel verloren hatten, ihre Arbeit, ihren Status, ihr Selbstwertgefühl. Sie waren, anders als ich, nicht im richtigen Alter und unter den richtigen Umständen in diese Zeitenwende gerutscht.
Und damit bin ich wieder bei dieser Bundestagswahl und der hellblauen DDR-Wahlkarte. Dass die AfD im Osten seit Jahren doppelt so stark abschneidet wie im Westen, hat mit demografischen, sozialen und ökonomischen Unterschieden zu tun, und ja, auch mit autoritären Prägungen, extremen Neigungen oder einem anderen, wie soll ich sagen: serviceorientierten Verständnis von Demokratie. Aber es hat auch damit zu tun, dass der östliche Teil Deutschlands den Bruch nach 1989 tatsächlich durchlebte, während der westliche Teil vor allem zuschaute.
Die Bonner Republik existierte einfach weiter, auch dann noch, als das Parlament und Teile der Regierung nach Berlin umzogen. Und ihre Elite herrschte, nicht nur im Bund, sondern zum großen Teil auch in den vorgeblich neuen Ländern – wo sich, und das ist keine Übertreibung, alles änderte.
Das meiste war besser, natürlich war es das. Aber es war eben auch anders, neu, riskant. Die Menschen mussten sich komplett umstellen, und für viele war diese Erfahrung traumatisch.
Das Trauma wirkt bis heute nach
Dieses Trauma wirkt in einem Teil der Gesellschaft nach, über Generationen hinweg. Und es erzeugt immer noch Gefühle wie Trotz und Angst, die, nachdem PDS und Linke davon gelebt hatten, nun insbesondere von der AfD vereinnahmt werden.
Gerade bei westdeutschen Extremisten wie Björn Höcke, die den Osten für ihre völkische Ideologie bewirtschaften, lässt sich gut beobachten, wie sogenannte Errungenschaften der DDR mit einer besonders verkitschten Heldenerzählung von 1989 vermischt werden. Gleichzeitig versprechen sie ein Zurück zur angeblich guten, alten Bundesrepublik, mit harter D-Mark, aber ohne unerwünschte Ausländer.
Die Trauma-Ausbeutung funktioniert umso besser, wenn gerade wieder ein Epochenwechsel dräut. Die unipolare Weltordnung, die ab 1989 zu entstehen schien, erodiert schon seit Längerem. Inzwischen befindet sich auch das damals zum historischen Sieger erklärte westliche Demokratiemodell in der Defensive, inklusive der Wiederkehr von Nationalismus und nackter Expansionspolitik.
Es ist gerade so viel gleichzeitig in Bewegung, und dies überall, dass es unmöglich ist, den Überblick zu behalten, erst recht dann, wenn die meisten Informationen aus sozialen Netzwerken stammen und eher Desinformationen sind. Die AfD nutzt die Stimmungslage im Osten besonders effizient, indem sie das Erfolgsgefühl der 89-er Disruption parallel zu den Verlust- und Demütigungserfahrungen der Transformation abruft.
Und dennoch, und jetzt komme ich doch noch zu der sportlichen Überschrift, wegen der Sie vielleicht diese Kolumne anklickten, haben viele ostdeutsche Menschen den Westdeutschen inklusive Alice Weidel etwas voraus – oder zumindest jenen, für die sich der Herbst 1989 irgendwo zwischen dem Sommerurlaub an der Adria und Skiferien in Vorarlberg einordnete: Sie haben es schon einmal durch.
Alle bislang erschienenen Kolumnen von Martin Debes finden Sie hier.
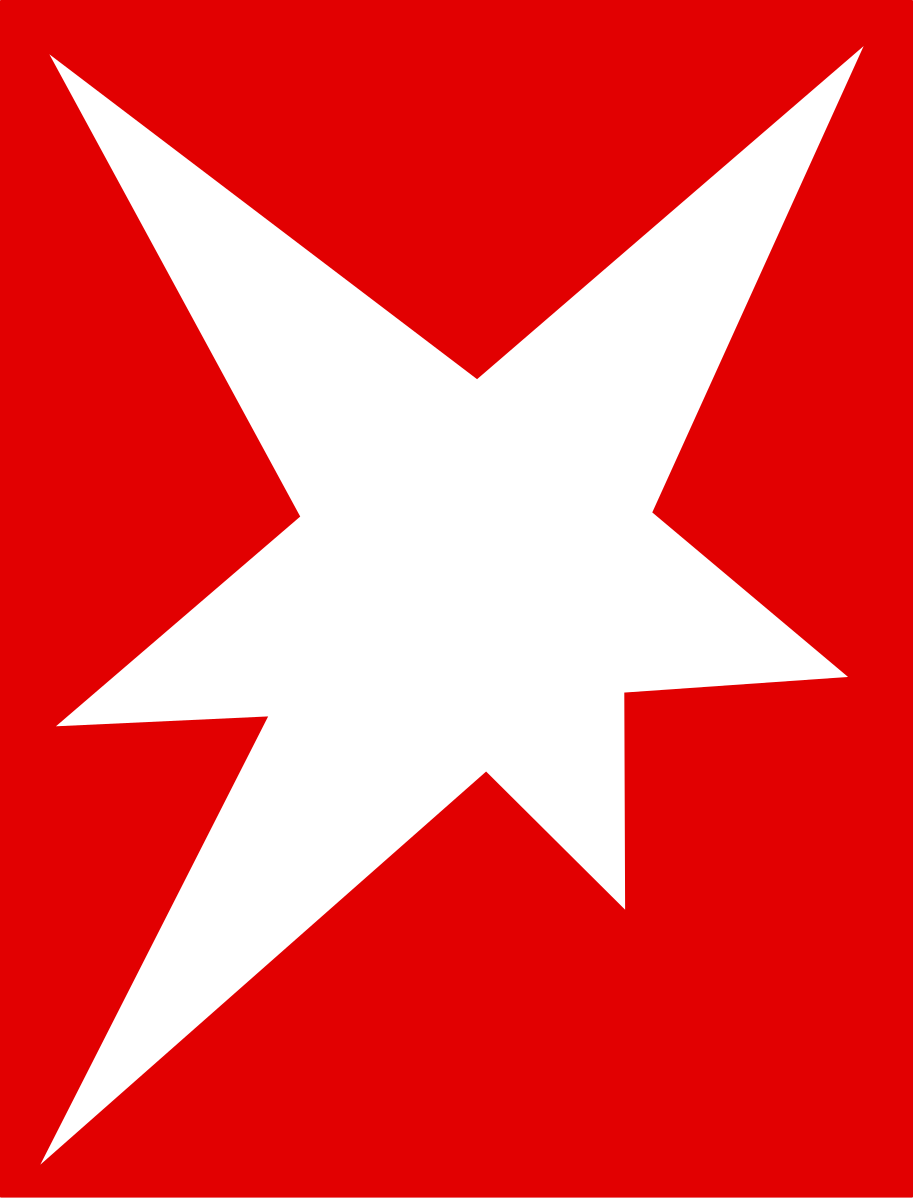 9 hours ago
9 hours ago