Die Tage bis zur Bundestagswahl verstreichen, und unsere Autorin kann sich für keine Partei entscheiden. Ist das normal? Und warum fällt die Wahl so schwer? Eine Spurensuche.
"Weißt du schon, wen du wählst?", fragt meine Mutter eines Abends am Telefon. In diesem Moment hätte ich mit ihr über alles gesprochen – nur nicht über Politik. Über vier Stunden habe ich heute die Abstimmung zum umstrittenen Migrationsplan der Union verfolgt und darüber berichtet. Jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben.
In zweieinhalb Wochen steht aber die vorgezogene Bundestagswahl an, und natürlich ist sie das Gesprächsthema Nummer eins – an Bahnhaltestellen, am Nebentisch im Café, im Freundeskreis und auf der Arbeit sowieso. Um den Satz "Weißt du schon, wen du wählst?" komme ich nicht herum.
In den ersten Wahlkampftagen war das noch eine spannende Frage. Aber je näher der 23. Februar rückt, desto nerviger wird sie. Jeder in meinem Umfeld scheint genau zu wissen, wen er wählen wird. Und jeder scheint sich sicher zu sein, dass seine Wahl die einzig richtige Entscheidung für dieses Land ist.
Nur ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten politischen Match. Peinlich für jemanden, der sich fast täglich mit den wahlkampfpolitischen Querelen aus Berlin beschäftigt.
Willkommen im Club der Unentschlossenen
Ein Blick in die aktuellen Umfragen verrät mir immerhin: Auch andere haben Entscheidungsprobleme. Wenige Tage vor der Wahl wissen ungefähr ein Drittel aller Wahlberechtigten in Deutschland nicht, wem sie am 23. Februar ihre Stimmen geben werden. Im ARD-Deutschlandtrend nennen 13 Prozent der Befragten unverbindlich eine Partei. 18 Prozent haben sich nicht ansatzweise entschieden oder überlegen, die Abstimmung sausen zu lassen. Millionen Menschen sind in etwa so unschlüssig wie ich.
Das sind deutlich weniger als bei der Bundestagswahl 2021. Damals war die Zahl so hoch wie nie in der Geschichte Deutschlands.
An der Wahlentscheidung beiße ich mir vom ersten Zähneputzen bis zum Schlafengehen die Zähne aus.Und zwar so lange, bis ich mich bei dem Gedanken ertappe, es einfach sein zu lassen. Laut Friedrich-Ebert-Stiftung stellen die Nichtwähler immerhin die größte Gruppe der Wahlberechtigten.
Ich verwerfe den Gedanken, grüble weiter, zweifle an meinem politischen Einschätzungsvermögen. Wie kann eine Wahlentscheidung nur so schwerfallen?
Als ich noch wusste, wem meine Stimme gehört
Auf der Suche nach Rat telefoniere ich mit Manfred Güllner, dem Chef und Gründer des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Wenn mir jemand helfen könnte, dann ein Wahlforscher, denke ich.
"Ist es normal, dass ich eine Woche vor der Wahl nicht weiß, wen ich wählen soll?", will ich wissen. "Nein", sagt Güllner, das sei eine neue Erfahrung. 40 Prozent der von Forsa befragten Wähler hätten aber dasselbe Problem wie ich.
Zum dritten Mal in meinem Leben darf ich bei einer Bundestagswahl abstimmen, aber solche Entscheidungsschwierigkeiten hatte ich noch nie.
Politisch habe ich mich immer mittig bis konservativ verortet. Schon in der Schule bekam ich von einer Klassenkameradin regelmäßig zu hören: "Mensch, Christine, du bist soooo konservativ!" Die Beschreibung schaffte es sogar ins Abibuch, bezog sich damals aber mehr auf meinen Lebensstil denn auf meine politischen Einstellungen. Aber die Grenzen sind ja bekanntlich fließend. Mein Elternhaus: christlich und gutbürgerlich. Das Familienbild: traditionell.
Damit standen auch meine ersten Wahlentscheidungen fest.
Zu wenige Themen und zu viele Probleme
2021 hatte ich die Nase voll von der GroKo. Meine damaligen Hauptanliegen – kein Unterrichtsausfall mehr, genügend Lehrkräfte, saubere Schulklos und einigermaßen ordentliche Unigebäude – waren meiner Meinung nach sträflich vernachlässigt worden. Unterdessen schrumpften meine Aussichten auf eine halbwegs sichere Rente, während sich die Prognosen für steigende Sozialversicherungsbeiträge mehrten. Die aufstrebende Umweltbewegung warf mit dem Klimawandel einen neuen Dauerbrenner auf, der mich faszinierte wie besorgte.
Zeit, eine andere Partei zu wählen.
Klimapolitik war dank Fridays for Future en vogue, und dieses Feld wollte keine Partei allein den Grünen überlassen. Dementsprechend war jedes Wahlprogramm grün gefärbt. Die Sozialdemokraten schickten einen potenziellen Klimakanzler ins Rennen, Die Linke warb mit einem 15-Punkte-Plan fürs Klima, die Christdemokraten gründeten eine Klimaunion, und die FDP rief zum "German Mut" gegen die Klimakrise auf. Wenn man sich nur aufs Klima konzentrierte, dann fiel die Entscheidung nicht so leicht.
Fast vier Jahre später verlieren die Parteien kaum ein Wort über das Klima. Der Wahlkampf dreht sich um Wirtschafts- und Migrationspolitik. Diesmal will man vor allem der AfD das Feld streitig machen.
Es sei nicht das erste Mal, dass in einem Wahlkampf ein Thema dominiert, meint Wahlforscher Güllner. "Aber eine Modernisierung des Staates und gesellschaftliche Innovationen, das waren 1969 und auch 1998 die Gewinnerthemen der SPD. Sozusagen eine Klammer, die in der Summe viele für die Menschen wichtige Bereiche abdeckte." Für die Asylpolitik gelte das jedoch nicht. Das sei ein Problem dieses Wahlkampfes, so Güllner.
Ich persönlich will meine Entscheidung nicht davon abhängig machen, wer sich im TV-Quadrell mit Abschiebeplänen übertrumpfte. Mich interessieren andere Probleme. Unter der Ampelregierung sind die Lebensmittelpreise um 30 Prozent gestiegen, was sich mindestens einmal pro Woche beim Einkaufen bemerkbar macht. Wer kümmert sich darum?
Die Wahlprogramme kann man abhaken – das tut sich doch kaum einer an.
In der Hoffnung auf eine zündende Idee wühle ich mich zwei Wochen vor der Bundestagswahl durch die Wahlprogramme. Ich hätte es lassen sollen. Jede Partei versucht, alles anzubieten. Was ich lese (oder überfliege), hat den schalen Geschmack eines All-you-can-eat-Büfetts: breites Angebot ohne Qualität. Die meisten Themen, die mir persönlich wichtig sind, sind in den Programmen nebensächlich. Manchmal werden sie benannt, aber Lösungen finde ich kaum.
"Die Wahlprogramme kann man abhaken – kaum lesbar, das tut sich doch kaum einer an", kommentiert Wahlforscher Güllner, als ich von ihm wissen will, welche Kanäle und Plattformen mir die Wahlentscheidung erleichtern könnten. Die klassischen Medien, also TV-Duelle und Wahlwerbung, seien in den meisten Fällen ausschlaggebend. Habe ich alles gesehen, geholfen hat es nicht.
Einigermaßen ratlos machen mich auch die Wahlplakate. Auf dem Weg zur Arbeit starre ich auf Habeck, der in großen Lettern für "Zuversicht" wirbt. Was soll mir das sagen? Die Konkurrenz macht es kaum besser: Auf fast jedem Plakat prangen allgemeine, nichtssagende Phrasen.
Auch Güllner ärgert sich, wie man den zuständigen Werbeagenturen überhaupt noch so viel Geld dafür zahlen könne. "Früher haben die Parteien noch versucht, klarzumachen, wie sie die Gesellschaft zukünftig gestalten wollen. Was heute auf den Plakaten steht, nehmen die Wähler kaum noch wahr", sagt er.
Warum hört uns denn keiner?
Anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl bin ich so desillusioniert, dass ich zum ersten Mal ernsthaft den Wahl-O-Maten befrage. Sonst war das immer eine Spielerei. Richtig ernst genommen habe ich das Ergebnis nie. Musste ich auch nicht, weil sich das Resultat meist mit meiner Parteipräferenz deckte.
Nicht so in diesem Jahr. Das Ergebnis leuchtete dunkelrot. Mein Freund scherzt, er sei mit einer eingefleischten Marxistin zusammen. Ich frage mich, ob beim Wahl-O-Maten etwas schiefgelaufen ist.
Dann denke ich wieder, dass es ein Privileg ist, in einer Demokratie leben zu dürfen. Ohne dieses System sähe mein Leben ganz anders aus.
Das Ergebnis passt allerdings zu einer aktuellen Studie des Instituts für Generationenforschung. Demnach stimmen Erstwählerinnen vor allem für Die Linke, männliche Erstwähler für die rechtskonservative Seite. Generationenforscher und Studienautor Rüdiger Maas erklärt das in einer Mitteilung so: "Viele junge Wähler fühlen sich überhört oder ignoriert und flüchten deshalb an die politischen Ränder."
Um es im Jugendsprech zu sagen: Ich fühle das!
Viele Themen, die meine und nachfolgende Generationen betreffen, spielen im Wahlkampf höchstens eine untergeordnete Rolle. Fernsehduelle und -quadrelle drehen sich vor allem um Außenpolitik, Migration und Wirtschaft. Niemand verliert ein Wort über fehlende Lehrkräfte oder unser mangelhaftes Bildungssystem. Kaum ein Politiker spricht ernsthaft über Lösungen für fehlende Kitaplätze, wie man junge Familien entlasten, die Renten künftiger Generationen sichern oder bezahlbaren Wohnraum schaffen könnte. Vom Klimawandel ganz zu schweigen.
Sind wir Jungwähler überhaupt noch interessant für Berlin? In der Generationenstudie heißt es: "Viele Parteien nehmen ihre Anliegen (die der Erstwähler, Anm. d. Red.) kaum auf und betrachten sie als unzuverlässige Wählergruppe."
Welche Wahl ich jetzt noch habe
Eine Woche vor der Wahl frage ich mich, wie sinnvoll es ist, Parteien zu wählen, die für meine Generation und jüngere nichts übrig haben.
Dann wieder denke ich, dass es ein Privileg ist, in einer Demokratie leben zu dürfen. Ohne dieses System sähe mein Traumjob, ja mein Leben, ganz anders aus.
Eine befriedigende Wahloption fehlt mir trotzdem. "Du musst halt das geringste Übel wählen", belehrt mich meine jüngere Schwester. Finde mal das geringste Übel in der Übelsammlung, denke ich.
Wahlforscher Güllner verweist auf Ostdeutschland, wo es mehr Nicht- als AfD-Wähler gegeben habe, und mahnt: "Wenn man nicht wählt, stärkt man die Extreme."
Kurz vor dem 23. Februar lese ich: Fast jeder Fünfte entscheidet sich erst in diesen letzten Tagen vor der Wahl – sieben Prozent sogar erst am Wahltag!
So weit will ich es aber doch nicht kommen lassen. Ich zwinge mich zu einer Entscheidung. Taktisch wählen ist jetzt meine Lösung. Im Kopf gehe ich die aus meiner Sicht besten Kombinationen durch und hoffe, dass das geringste Übel dabei herausspringt.
Eine Stimme ist besser als keine Stimme.
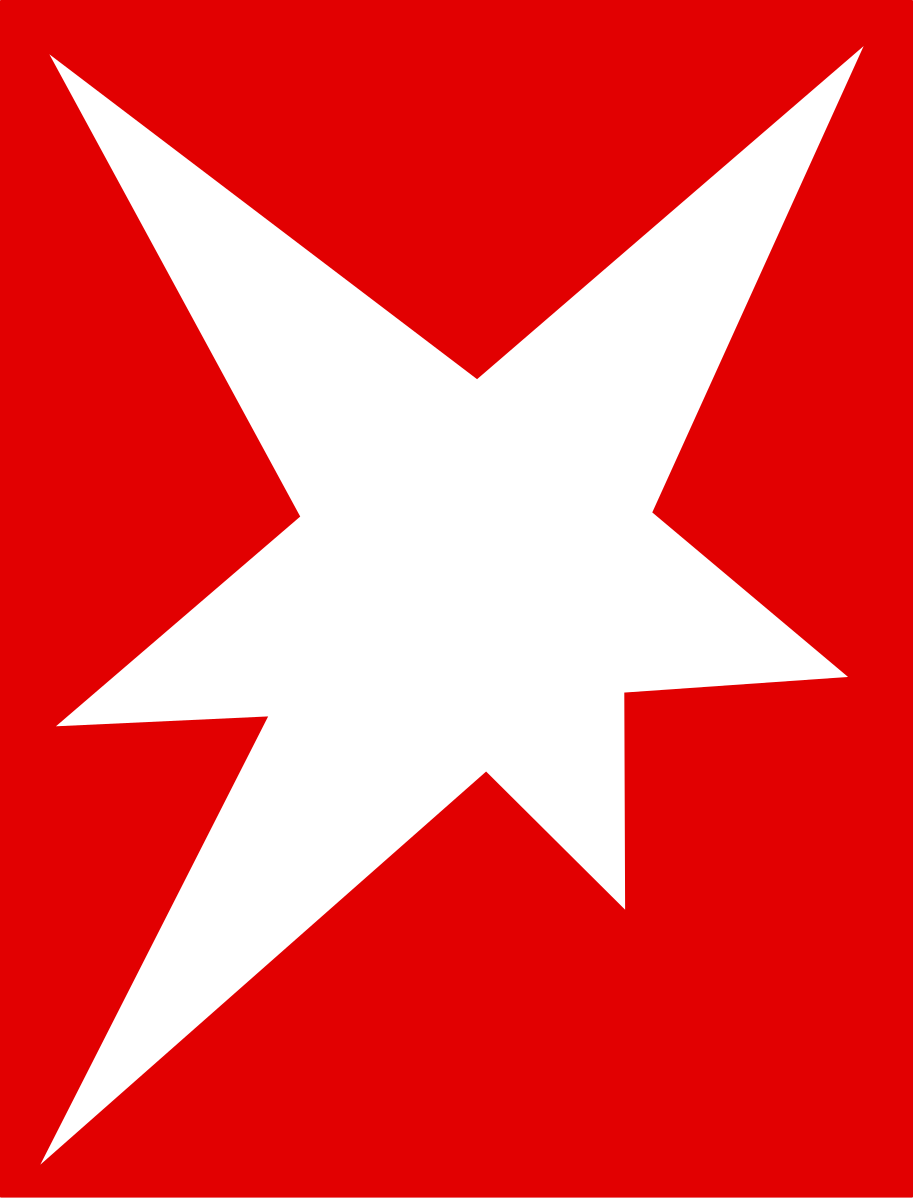 3 days ago
3 days ago












