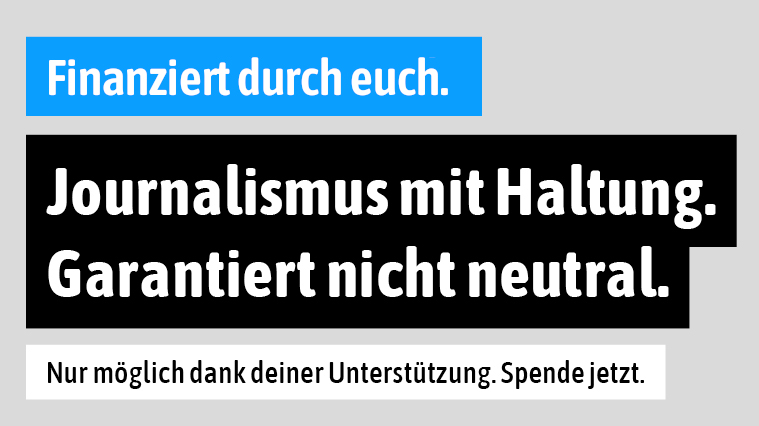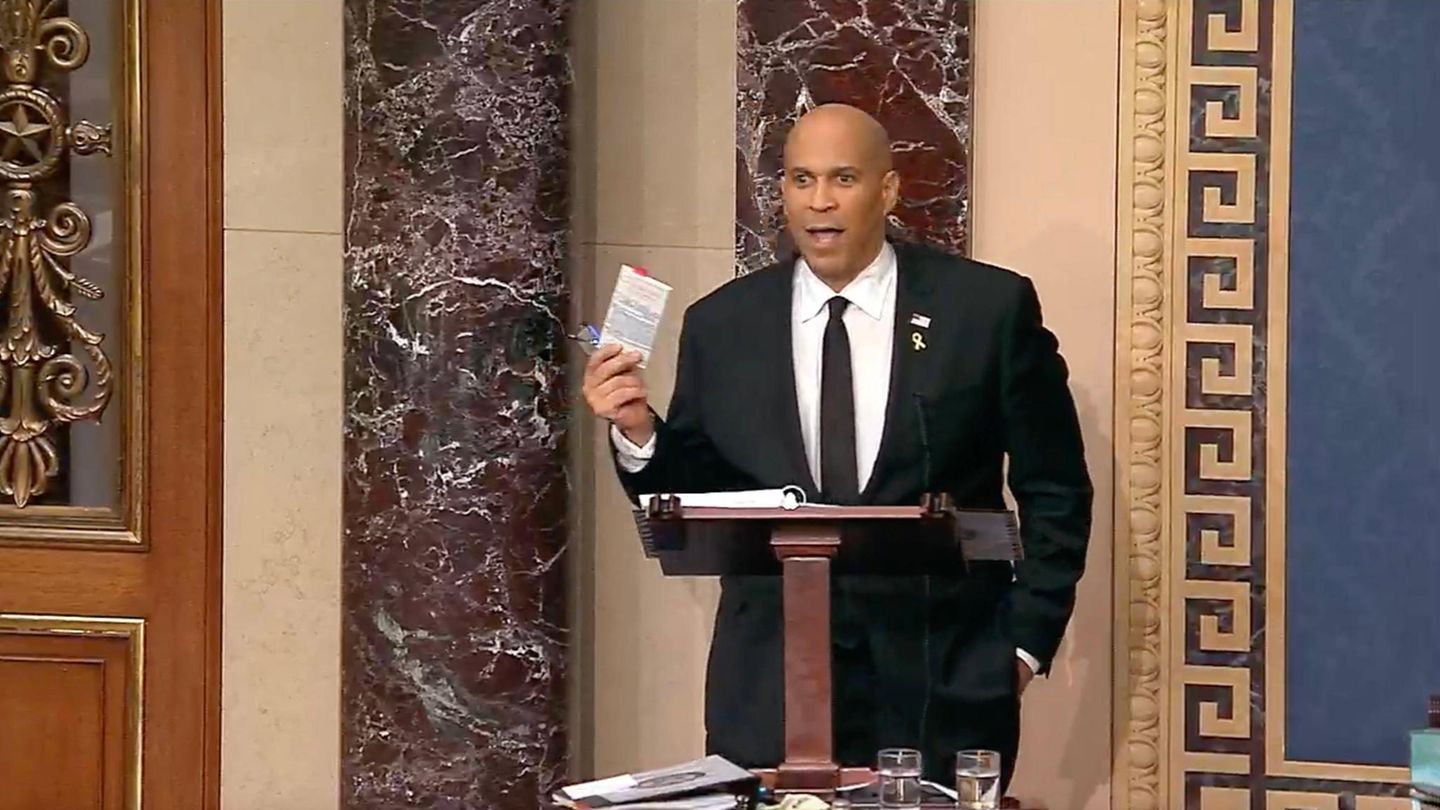Die Union will in der Koalition mit der SPD Messenger und Co. zur Entschlüsselung und Weitergabe von Kommunikationsinhalten verpflichten. Digital-, Menschenrechts-, Umwelt- und Journalistenorganisationen halten das für „unverhältnismäßig“ und einen „tiefen Eingriff“ in die Grundrechte mit gravierenden Folgen für die nationale Sicherheit und die Demokratie.
 Mit der Chatkontrolle würde es keine unbeobachtete Kommunikation mehr geben. (Symbolbild) – Public Domain generiert mit Midjourney
Mit der Chatkontrolle würde es keine unbeobachtete Kommunikation mehr geben. (Symbolbild) – Public Domain generiert mit MidjourneyDas Verhandlungspapier von Union und SPD zur Innen- und Sicherheitspolitik setzt die Axt an Grundrechten an. Doch die CDU will so weit gehen, dass sie fordert, dass Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste „im Einzelfall zur Entschlüsselung und Ausleitung von Kommunikationsinhalten an Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden“ verpflichtet werden. Im Verhandlungspapier lehnt die SPD diese hingegen explizit ab.
Käme die Forderung der Union in den Koalitionsverhandlungen durch, wäre einer Umgehung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Hintertüren der Weg geebnet. Zusätzlich würde die Forderung letztlich ein Ja zur umstrittenen EU-Chatkontrolle bedeuten, die derzeit auch am Widerstand Deutschlands scheitert. Wir haben Digital- und Menschenrechtsorganisationen sowie Umwelt- und Journalistenverbände gefragt, was sie von der Forderung der Union halten.
„Tiefer Eingriff in Grundrechte“
Christoffer Horlitz, Experte für Menschenrechte im digitalen Zeitalter bei Amnesty International, kritisiert das Vorhaben als einen „tiefen Eingriff in die Grundrechte aller Menschen“. Durch so etwas werde die Arbeit von Menschenrechtler:innen, Journalist:innen und Oppositionellen weltweit gefährdet.
Elina Eickstädt, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, sagt: „In einer Demokratie, in der vertrauliche Kommunikation unmöglich gemacht wird, ist eine lebendige Zivilgesellschaft unmöglich.“ Anstatt immer weiteren Überwachungsträumen nachzujagen, sollte die zukünftige Koalition lieber darüber reden, wie eine gute digitale Gesellschaft für alle aussieht.
„Gefährdet Vertraulichkeit von Recherchen“
Bei Reporter ohne Grenzen fürchtet man hingegen um die Pressefreiheit. Es stelle sich die Frage, inwieweit die Koalitionspartner den journalistischen Schutz im digitalen Zeitalter tatsächlich ernst nehmen würden. „Sicher verschlüsselte Dienste sind für Medienschaffende ein essenzielles Mittel der Recherche und Kommunikation“, so Helene Hahn, Referentin für Internetfreiheit. „Wer dieses Instrument in Frage stellt und Hintertüren für Sicherheitsbehörden offenhält, gefährdet die Vertraulichkeit journalistischer Recherchen und damit die Kontrollfunktion der Medien in einer Demokratie.“ Was die Union fordere, führe dazu, dass verschlüsselte Kommunikation weltweit geschwächt würde.
Hanna Möllers, Justiziarin des Deutschen Journalisten-Verbandes, stellt fest, dass viele Grundrechtseinschränkungen im Namen der Sicherheit vor allem aus symbolischen Gründen erfolgen, damit die Politik behaupten kann, „etwas getan zu haben“. Statt mehr Überwachung und Kontrolle fordert der Verband „von den Parteien mutige und überzeugende Initiativen zur Stärkung der Freiheitsrechte“.
„Gefährdet nationale Sicherheit“
Erik Tuchtfeld, Co-Vorsitzender des netzpolitischen Vereins D64, warnt vor Auswirkungen auf die Sicherheit aller: „Die Schwächung verschlüsselter Kommunikation gefährdet die nationale Sicherheit. Es gibt keine ‚Hintertüren nur für die Guten‘ – wenn sie eingebaut werden, werden sie auch von feindlichen Akteuren genutzt.” Die Co-Vorsitzende Svea Windwehr fordert, dass sich der Koalitionsvertrag stattdessen explizit für den Schutz von Verschlüsselung und vertraulicher Kommunikation aussprechen solle, sonst werde er den Grundwerten einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft nicht gerecht.
Tom Jennissen vom Verein Digitale Gesellschaft warnt vor einem „autoritären Umbau des Staates und dem Aushöhlen rechtsstaatlicher Grundsätze“ durch die Union. „Statt sichere und vertrauliche Kommunikation als Voraussetzung einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu stärken, werden auf Zuruf der Sicherheitsbehörden und ihrer Lobbyverbände deren rechtliche und technische Grundlagen angegriffen“, so Jennissen weiter.
Wikimedia Deutschland, der Verein hinter der deutschen Wikipedia, möchte, dass sich Menschen im Netz frei engagieren und Wissen teilen können – ohne Angst vor Überwachung. „Die Politik muss der Versuchung widerstehen, Verschlüsselungstechnologien aufzuweichen, die nur vermeintlich für mehr Sicherheit sorgen“, sagt Lilli Iliev, Leitung Politik & Öffentlicher Sektor.
„Dystopischer Schundroman“
„Die CDU hat sich offenbar von Orwells dystopischem Roman 1984 inspirieren lassen“, sagt Noa Neumann von Attac Deutschland. Das Vorhaben sei „nicht vereinbar mit unseren freiheitlichen Grundrechten“. Attac erwarte von einer Bundesregierung, dass sie die Rechte und die Privatsphäre von Menschen aktiv schütze und nicht den Datenschutz aushöhle.
Auch Britta Rabe vom Komitee für Grundrechte und Demokratie fühlt sich an Literatur erinnert, allerdings von eher minderer literarischer Qualität: „Das Koalitions-Verhandlungspapier liest sich wie ein dystopischer Schundroman. Hier soll endgültig die Büchse der Pandora geöffnet werden – mit verheerenden Folgen etwa für marginalisierte Gruppen, Zivilgesellschaft und Engagement.“
„Unverhältnismäßig“
Greenpeace-Sprecherin Eva Schaper sieht die Forderung der Union als „Teil eines politischen und gesellschaftlichen Roll-backs“. Unter dem Schlagwort „Sicherheit“ würden Datenschutz und Freiheitsrechte, aber auch Informationsrechte zurückgeschnitten. „Setzt sich das durch, werden wir sehr schnell in ein weniger freien, letztlich aber auch unsicheren Gesellschaft leben.“
Die Humanistische Union hält die Forderung der Union für „einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte“. Philip Dingeldey, Geschäftsführer der Bürgerrechtsorganisation, warnt vor einem verengten Blick auf „technokratische Überwachungsinstrumente, die unsere Freiheitsrechte auf skandalöse Weise bedrohen“.
Rena Tangens von Digitalcourage kritisiert, dass sich die Konservativen immer weiter vom Bewahren der gesellschaftlichen Ordnung entfernten. „Wer unsere bürgerlichen Freiheiten durch immer weitere Gängelung und Überwachung angreift, hat sich von diesem Wertebegriff offenbar verabschiedet“, so Tangens. Bei der Union gäbe es keine Einsicht, dass „unser Rechtsstaat kein Ort für ein Überwachungs-Wunschkonzert ist“.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.