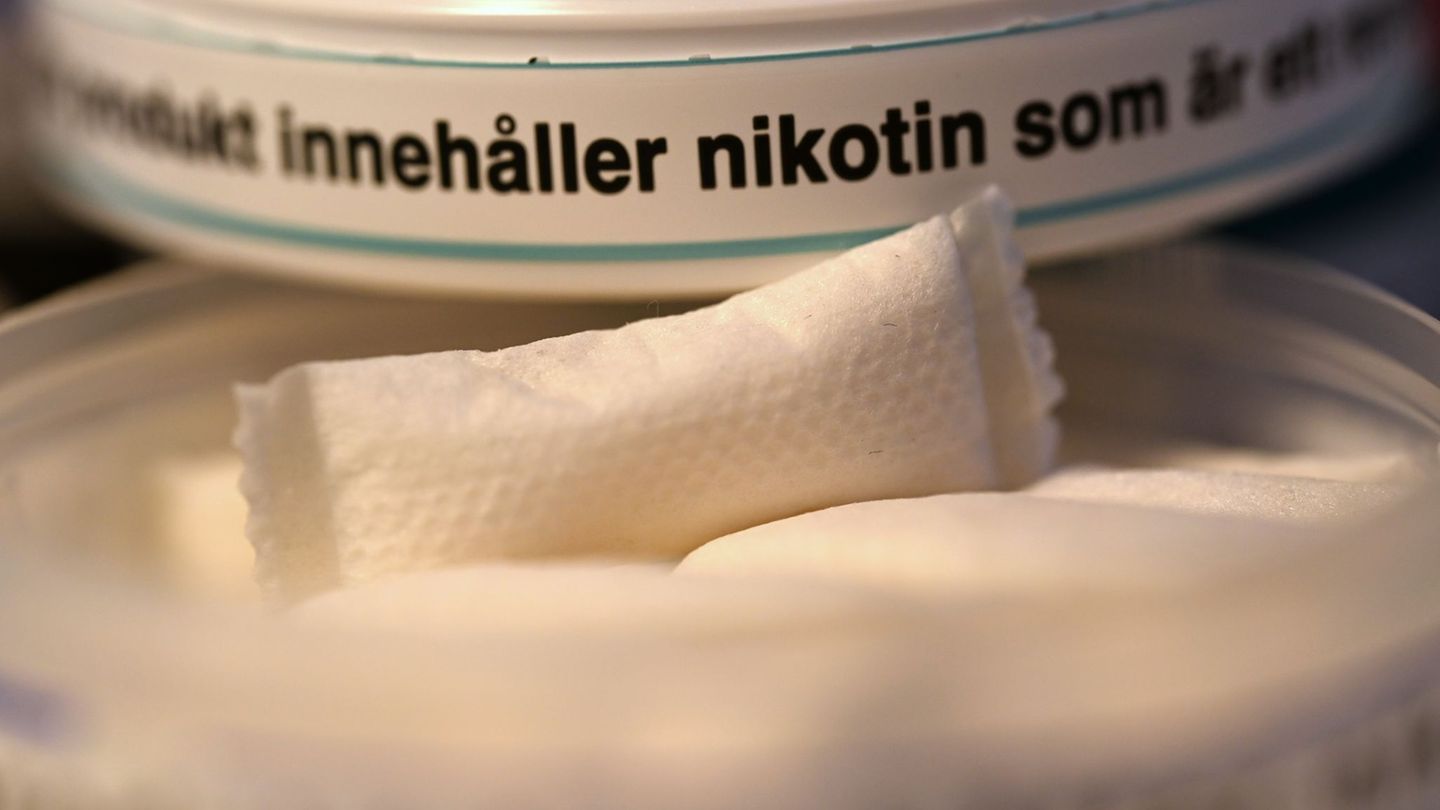Lange stand das Heizungsgesetz mit seinen Pflichten zur energetischen Sanierung in der Kritik. Vor der Wahl gehen die Meinungen auseinander. In Koalitionsverhandlungen dürfte wohl hart darum gerungen werden.
Das Heizungsgesetz war einer der größten Aufreger und Streitpunkte der bald endenden Legislaturperiode. Darin geht es um die Pflichten zur energetischen Sanierung für Hausbesitzer. Von Anfang an gab es Kritik, weil es viele kleinteilige Regelungen gebe.
Vor der Bundestagswahl mehren sich nun erneut die Stimmen für eine grundlegende Überarbeitung. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) - so der offizielle Name - müsse verständlicher und praxistauglicher für die Menschen gestaltet werden, fordert etwa der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie. Die komplexen Regelungen würden von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern als Zwang empfunden. Was fordern die Parteien?
SPD strebt Überarbeitung an
Die SPD will zwar am GEG festhalten, es aber einem "Praxischeck" unterziehen, entbürokratisieren und einfacher formulieren, wo es ohne Gefährdung der Zielerreichung möglich sei. Das kündigte Verena Hubertz, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, an. Ohnehin müsse das Gesetz zur Umsetzung einer europäischen Richtlinie über die Effizienz von Gebäude novelliert werden.
Generell stehe die SPD-Bundestagsfraktion aber hinter dem Heizungsgesetz. "Die vorgeschaltete kommunale Wärmeplanung in Kombination mit einer umfangreichen, sozial ausgeglichenen Förderung macht den Umstieg auf erneuerbare Heizungen für die Breite der Gesellschaft machbar."
Bereits zuvor hatte sich Bauministerin Klara Geywitz für eine grundlegende GEG-Reform ausgesprochen. Das Gesetz müsse "viel, viel" einfacher gemacht werden, so die SPD-Politikerin.
Union will Kurswechsel
Die Union spricht sich für einen grundlegenden Kurswechsel aus. "Wir werfen den Rucksack der Überregulierung ab, den die Ampel mit ihrem Heizungsgesetz auf das Gebäudeenergiegesetz gepackt hat", sagte Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der CDU sowie klima- und energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
"Eine neue Dynamik gibt es nur mit neuem Vertrauen. Für den Weg zu klimaneutraler Wärme setzen wir deshalb auf klare Rahmenbedingungen: schrittweise CO2-Bepreisung mit Sozialausgleich, verlässliche Förderung und eine technologieoffene Strategie der Ermöglichung."
Die CDU wolle eine "einfache Botschaft" geben, so Jung. "Die neue Heizung muss klimafreundlich betrieben werden können - und dafür gibt es unterschiedliche Wege: Wärmepumpe und Wärmenetze genauso wie nachhaltige Holzpellets, Solarthermie, Geothermie oder grüne Gase."
Das Heizungsgesetz habe Millionen Hauseigentümer verunsichert, sagte Jens Spahn, der stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, jüngst auf dem Parteitag. Die Union werde das Gesetz rückgängig machen, erklärte er.
Zudem soll auch die Förderung für den Heizungstausch deutlich gekürzt werden. Es soll laut Jung aber weiter Unterstützung für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung geben - ohne Ungleichheiten durch die "Hintertür der Förderregeln".
Mit Einnahmen der CO2-Bepreisung für Wärme und Verkehr will die Union in einem ersten schnellen Schritt Stromsteuer und Netzentgelte senken. Seit langem in der politischen Debatte ist außerdem ein Klimageld.
Wie die FDP zum Gesetz steht
Auch die FDP, die das Heizungsgesetz 2023 mitbeschlossen hatte, möchte es wieder abschaffen. Die Partei hatte in der damaligen Ampel wesentliche Änderungen an den ursprünglichen Plänen durchgesetzt. Nun heißt es im Wahlprogramm: "Freiheit im Heizungskeller."
Statt "unzähliger Einzelvorschriften" setzt die FDP auf eine marktwirtschaftliche Lösung, den CO2-Zertifikatehandel. "Das Heizungsgesetz mit seinen überzogenen Vorgaben muss vollständig auslaufen."
Um die sozialen Kosten des Klimaschutzes abzufedern, will die FDP eine "Klimadividende" einführen und die Energiebesteuerung drastisch absenken. Einen "Zwang" zum Anschluss an Fernwärmenetze lehnen die Liberalen ab. "Heizen mit Holz bleibt mit uns weiter möglich, Auflagen für Kamine und Öfen wollen wir reduzieren."
Grüne wollen Kurs fortsetzen
Die Grünen um Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Robert Habeck wollen dagegen an ihrem Kurs und dem Heizungsgesetz festhalten. Sie halten es weiterhin für richtig und wollen die Regelungen, so wie sie jetzt sind, beibehalten.
Im Wahlprogramm heißt es: "Die Energie- und Wärmewende setzen wir fort." Die Unterstützung für den Einbau einer modernen klimafreundlichen Heizung wie der Wärmepumpe solle ausgebaut werden.
Ein Großteil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wollen die Grünen als sozial gestaffeltes Klimageld an Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen auszahlen.
Was im Gesetz steht
Das Gebäudeenergiegesetz ist in seiner aktuellen Form seit Anfang 2024 in Kraft. Vorausgegangen waren lange und harte Verhandlungen innerhalb der Ampelkoalition. Ziel ist mehr Klimaschutz im Gebäudebereich. Im Wohnungsbestand heizen nach wie vor drei Viertel der Haushalte mit Gas oder Öl.
Künftig sollen alle Heizungen grundsätzlich mit einem Anteil von 65 Prozent Erneuerbarer Energie betrieben werden. Ein Umstieg auf klimafreundlichere Systeme wie Wärmepumpen soll wegen des steigenden CO2-Preises auf Dauer zudem Kostenersparnisse bringen.
Das Gesetz gilt allerdings erst einmal nur für neu eingebaute Heizungen und vorerst nur in Neubaugebieten. Funktionierende Öl- und Gasheizungen sollen erst einmal weiterlaufen und bei Bedarf repariert werden können. Sogar bei kaputten Heizungen gibt es eine fünfjährige Übergangsfrist.
Wie es dann letztlich weitergeht, hängt von den verpflichtenden und flächendeckenden kommunalen Wärmeplanungen ab. Sie sollen in Großstädten ab Mitte 2026 und für die restlichen Kommunen ab Mitte 2028 vorliegen.
Erst dann greifen strengere Regeln für den Einbau neuer Heizungen auch in Bestandsgebäuden. Hauseigentümer sollen dadurch Klarheit haben, ob sie zum Beispiel an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden oder ob sie sich bei einer neuen Heizung um eigene dezentrale Lösungen kümmern sollen - also zum Beispiel eine Wärmepumpe.
Derzeit noch umfangreiche Förderungen
Die Ziele der Bundesregierung zum Einbau neuer Wärmepumpen wurden bislang nicht erreicht, im vergangenen Jahr waren deutlich weniger neue Geräte verkauft worden als erwartet. Die staatliche Förderbank KfW verzeichnet aber seit Jahresende 2024 deutlich mehr Nachfragen nach staatlichen Förderungen.
"Wir sehen das an den Zahlen, dass dort gerade modernisiert wird - auch aus Angst, dass die CDU diese attraktive Förderung abschafft", sagte Christina-Johanne Schöder, die bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion.
Für den freiwilligen Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung gibt es aktuell noch umfangreiche Subventionen. Für den Heizungsaustausch zahlt die KfW im besten Fall 70 Prozent der Kosten. Die maximal förderfähigen Ausgaben liegen bei 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus. Demzufolge sind umgerechnet bis zu 21.000 Euro drin.
Allerdings ist die Förderung nicht gerade einfach zu durchblicken: Es gibt neben der Grundförderung von 30 Prozent einen Klimageschwindigkeitsbonus sowie einen Einkommensbonus. Darüber hinaus bietet die KfW für eine Rundumsanierung verschiedene zinsvergünstigte Kredite an.