Friedrich Merz soll am Dienstag zum neuen Bundeskanzler gewählt werden – aber wie beobachten eigentlich internationale Medien den künftigen Kanzler? Ein Überblick.
Olaf Scholz wurde beim Großen Zapfenstreich mit den Beatles aus dem Kanzleramt verabschiedet, am Dienstagvormittag wählt der Bundestag den neuen Bundeskanzler. Friedrich Merz soll es werden, doch der ist im ersten Wahlgang knapp gescheitert. Seine Beliebtheit schwindet in Deutschland, doch wie sieht es international mit seinem Ansehen aus?
In einer Sache sind sich die Medien fast durchgehend einig: Merz wird es anders machen als sein Vorgänger. Und er wird es dabei alles andere als einfach haben. Die Pressestimmen aus dem Ausland:
"The New York Times", New York: "Der neue Kanzler und seine Koalitionsregierung unter Führung seiner Mitte-Rechts-Partei CDU werden mit einer Reihe nationaler Krisen konfrontiert sein, darunter eine stagnierende Wirtschaft und angespannte Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.
Eine aufstrebende nationalistische Partei, die einwanderungsfeindliche Alternative für Deutschland (AfD), die vom deutschen Verfassungsschutz gerade als extremistisch eingestuft wurde, hat Merz und seine politischen Mainstream-Kollegen in einigen Umfragen überholt.
In den Monaten seit dem Wahlsieg seiner Partei im Februar ist Merz diese Herausforderungen aggressiv angegangen.
Er kritisierte Präsident Trump und stellte die Stabilität der amerikanischen Demokratie infrage. Außerdem traf er sich mit ausländischen Amtskollegen, um ein neues, starkes Europa anzuführen. Er brach schnell ein wichtiges Wahlversprechen zur Haushaltsdisziplin und schloss mit seinen Mitte-Links-Rivalen einen Deal, um die heiligen Grenzen der deutschen Staatsverschuldung zu lockern, damit 'alles, was nötig ist', für die Landesverteidigung ausgegeben werden kann."
"Wo Merkel Konflikte herunterspielte und Scholz zögerte, prescht Merz vor"
"Politiken", Kopenhagen: "Das deutsche Selbstverständnis balancierte jahrzehntelang zwischen europäischer Verantwortung und historischer Vorsicht. Die konservative Kanzlerin Angela Merkel galt lange als Inbegriff dieses Balanceakts: ruhig, geduldig und sachlich kraftvoll. Der Sozialdemokrat Olaf Scholz versuchte, diesen Stil weiterzuführen, begegnete aber einer Realität, in der Vorsicht nicht mehr als Stärke, sondern als Lähmung aufgefasst wurde.
Friedrich Merz verspricht nun eine neue Zeit, in der mit dieser Tradition gebrochen wird. Er steht für eine aktivere Führung und spricht offen über Pflicht und Tatkraft. Wo Merkel Konflikte herunterspielte und Scholz zögerte, prescht Merz vor.
Vielleicht ist endlich die Zeit dafür gekommen, die deutsche Identität nicht nur negativ – als nicht-nazistisch, nicht-nationalistisch, nicht-führend – zu definieren, sondern als eine positive Verantwortung, die eher von Ambitionen als von Schuld getragen wird."
"Rzeczpospolita", Warschau: "Am Dienstag übernimmt der CDU-Chef Friedrich Merz die Leitung der deutschen Regierung. Er stammt aus der gleichen europapolitischen Familie wie Polens Ministerpräsident Donald Tusk. Eine solche Parteinähe erleichtert normalerweise die Zusammenarbeit. In der Frage des großen Kriegs im Osten lehnt Merz Stillstand ab. In einer Zeit globaler Umwälzungen, die durch Donald Trumps Erklärungen und manchmal auch durch seine Taten ausgelöst werden, soll Deutschland nun investieren und sich wappnen.
Es stellt sich die Frage, ob die Führungsrolle von Merz beim Aufbau eines Europas ohne die USA (oder vielleicht gegen die USA) wirklich im Interesse Polens liegt. Kann Polen zum Beispiel in Fragen der Sicherheit und der Rüstungsindustrie im gleichen Tempo wie Deutschland von den USA unabhängig werden? Deutschland, das sich selbst keine militärischen Beschränkungen mehr auferlegt, kann schnell Fabriken von der zivilen Produktion auf Kanonen umstellen.
Und wir? Früher haben wir uns darüber geärgert, dass Deutschland keine Investitionen in Rüstung und Waffen tätigte und den russischen Imperialismus ignorierte. Heute können wir uns darüber freuen, dass die Deutschen die russische Bedrohung ernst nehmen und sich darauf vorbereiten, sich zu verteidigen. Aber was passiert in Zukunft? Und wie wird das aufgerüstete Deutschland aussehen? Ein dramatischer politischer Wandel muss ja nicht mit Trumps Amerika enden."
Friedrich Merz "muss unter allen Umständen die Ruhe bewahren"
"Neue Zürcher Zeitung", Zürich: "Die Länder des Westens befinden sich in einer Sinnkrise, alte Gewissheiten wie die Religion sind vielerorts weggebrochen, die Überalterung zersetzt dörfliche Strukturen und hemmt das wirtschaftliche Wachstum. Politisch befindet sich Merz in einer Situation, die weit ernster ist als zu Zeiten von Merkel oder Scholz. Von rechts bedroht die AfD die etablierten Parteien, von links der Versuch, die rechtsradikale Todeszone immer stärker auszuweiten, sowie ein neuer, sozialistischer Populismus. Ein aggressives Russland bedroht Europa.
Um in diesem Sturm zu bestehen, braucht Merz starke Nerven sowie einen unverwüstlichen inneren Kompass. Er darf die veröffentlichte Meinung nicht mit der öffentlichen verwechseln. Er sollte umgekehrt aber auch nicht das Aufbegehren gegen den Mainstream zur Richtschnur seines Handelns erheben, wie es bei Trump zuweilen den Anschein hat. Er muss unter allen Umständen die Ruhe bewahren."
"La Repubblica", Rom: "(...) In Zeiten turbulenter Veränderungen sollte die Führungsrolle von Bundeskanzler Merz genau beobachtet werden, da er möglicherweise eine Schlüsselrolle spielen könnte, vielleicht in Abstimmung mit Ursula von der Leyen. (...)
Die Fähigkeit, der AfD entgegenzuwirken, muss sich in der Praxis bewähren, doch die Wende Deutschlands, das in Infrastruktur, Verteidigung, Innovation und den ökologischen Wandel investiert, ist nicht zu unterschätzen und wird Auswirkungen auf ganz Europa haben.
Es wäre jedoch ein Fehler, sofortige Ergebnisse zu erwarten. Die Konjunktur in Deutschland ist nach wie vor alles andere als günstig, die Wachstumsprognosen für dieses Jahr liegen bei null. Und die Probleme, die sich in den letzten zwanzig Jahren angesammelt haben und nach Covid deutlich zutage getreten sind, werden nicht in wenigen Monaten verschwinden. (...)
Die Natur der Regierungskoalition in Deutschland bietet eine Gelegenheit, Mehrheit und Opposition mit ihren jeweiligen Gesprächspartnern zu gemeinsamen Zielen zu bewegen, angefangen bei der Finanzierung der europäischen Gemeingüter."
"Ein großes Versprechen"
"DNA", Straßburg: "(...) Dem Kanzler wird keine Schonfrist gewährt. Nicht außenpolitisch wegen des Ukraine-Konflikts und des von den USA ausgerufenen Handelskriegs, in die Deutschland in großem Umfang exportiert. Und auch nicht an der Heimatfront. Friedrich Merz steht zu seiner Linken in der Koalition mit den Sozialdemokraten unter Zwang. Zu seiner Rechten steigt die AfD, die vom Verfassungsschutz nun offiziell als rechtsextreme Partei eingestuft wird, unaufhaltsam auf.
Aufrüstung (bislang ein Schimpfwort in Deutschland), Ökologie, Einwanderung, mangelhafte Infrastruktur (...) Da er sich der Herausforderungen bewusst ist, hat er bereits auf die heilige deutsche 'Schuldenbremse' verzichtet, um 500 Milliarden freizugeben. Der traditionelle Atlantiker hat sich auch klar zum Fallenlassen von Trump geäußert, was paradoxerweise den deutsch-französischen Motor wieder ankurbeln könnte.
Frankreich erwartet viel von ihm. Zu viel? Unter seinem Vorgänger Olaf Scholz war die Beziehung ins Stocken geraten. In Merz' Büro hängt ein Foto von Adenauer und de Gaulle, die 1963 den Élysée-Vertrag unterzeichneten. Ein großes Versprechen. (...)"
"The Irish Times", Dublin: "Die Übernahme der Kanzlerschaft durch Friedrich Merz an der Spitze einer Koalition aus CDU/CSU und SPD lässt die meisten der europäischen Verbündeten seines Landes erleichtert aufatmen. Sie hoffen, dass Deutschland die wirtschaftliche Flaute und das politische Auseinanderdriften überwinden wird.
Schon jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass die vitale, einst dynamische deutsch-französische Führungsrolle erneuert wird. Zumindest ist das die Verheißung: Eine wiederbelebte Wirtschaft, verbunden mit dem Vorhaben, eine Billion Euro für Infrastruktur und Verteidigung auszugeben, was auch Europa insgesamt zugutekommen wird. Der größte Konjunkturimpuls seit dem Fall der Berliner Mauer – als Reaktion auf Donald Trumps Lavieren in Bezug auf die Nato-Verpflichtungen der USA. Ein starkes Engagement für eine unabhängige europäische Verteidigung, einschließlich der Solidarität mit der Ukraine – mit Waffen und der Bereitschaft, eine Nato-Mitgliedschaft in Erwägung zu ziehen. Und ein erneutes Engagement für die europäische Integration."

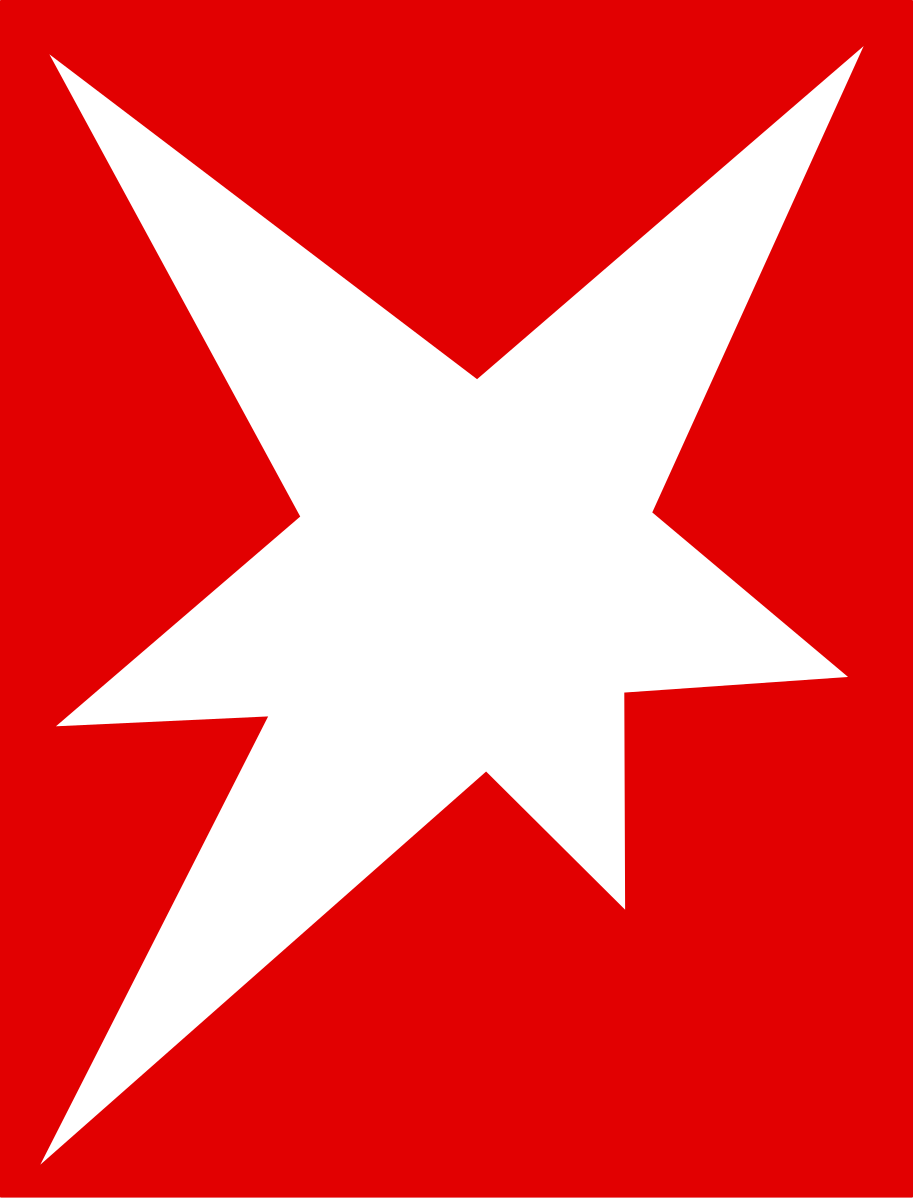 4 hours ago
4 hours ago 





