Kurz vor Kriegsende besiegt die Wehrmacht bei Bautzen die Rote Armee – ein letzter Triumph, der über 17.000 Menschen das Leben kostet.
Dieser Artikel erschien zunächst bei ntv.de
Am Mittag des 21. April 1945 liegen dichte Rauchschwaden über Bautzen. In den Straßen der ostsächsischen Stadt hallen Detonationen und Gewehrschüsse wider, während sich sowjetische Sturmtruppen Haus um Haus ins Zentrum vorkämpfen. Doch anders als in Berlin, wo Hitlers Truppen kurz vor der endgültigen Niederlage stehen, wendet sich hier das Blatt.
"In der Schlacht um Bautzen errang die deutsche Wehrmacht einen letzten, jedoch bedeutungslosen Sieg", sagt der Historiker Stefan Maximilian Brenner im Gespräch mit ntv.de. Der "örtliche Erfolg" habe den Kriegsverlauf nicht beeinflusst, stattdessen aber noch Tausenden Menschen das Leben gekostet. "Es war ein sinnloser Opfergang", fasst der Historiker am Kommando Heer zusammen.
In den Planungen der deutschen und sowjetischen Führungsstäbe spielt ein militärisches Aufeinandertreffen bei Bautzen gar keine Rolle. Das Hauptaugenmerk liegt auf Berlin. Am 16. April 1945 setzt die Rote Armee an der Oder mit einem Millionenheer zum Sturm auf die Reichshauptstadt an. Parallel dazu überqueren die 52. sowjetische Armee und die 2. polnische Armee die Neiße und stoßen nach Ostsachsen in Richtung Dresden vor. Ihre Aufgabe ist es, die südliche Angriffszange der "Berliner Operation" zu decken. Eines der Etappenziele: Bautzen.
Schlacht ist dem Zufall geschuldet
Die Übermacht der Sowjets und Polen scheint mit mehr als 120.000 Soldaten erdrückend. Doch der Schein trügt. Die 52. Armee unter Befehlshaber Konstantin Korotejew ist durch vergangene Schlachten personell und materiell stark geschwächt. Unwesentlich besser sieht es bei den Polen aus: Sie führen 400 Panzer aus sowjetischen Beständen ins Feld. Allerdings dienen unter General Karol Świerczewski überwiegend unerfahrene und schlecht ausgebildete Soldaten. Zudem können beide Armeen nicht auf große Reserven zurückgreifen. Diese werden für die Offensive auf Berlin benötigt. Mit nennenswertem Widerstand rechnet die Rote Armee in Ostsachsen nicht.
Doch das ist ein Irrtum. Die Verteidigung der Oberlausitz obliegt der 4. Panzerarmee mit etwa 50.000 Mann unter General Fritz-Hubert Gräser. Unter seinem Kommando stehen einige NS-Vorzeigeverbände wie die Fallschirm-Panzerdivision Hermann Göring und die Panzergrenadierdivision Brandenburg. Gräsers Divisionen sind dezimiert und haben nur noch die Stärke von Bataillonen. Zudem sind Munition und Treibstoff knapp. Aber noch hat die 4. Armee 350 gepanzerte Fahrzeuge - mehr als die Verteidiger von Berlin.
"Die deutschen Truppen waren in dieser Endphase des Krieges zutiefst demoralisiert", sagt Brenner. "Dennoch kämpften viele Soldaten weiter. Sie fürchteten die Standgerichte, welche Fahnenflüchtige innerhalb kürzester Zeit zum Tode verurteilten." Zudem habe die NS-Propaganda tatsächliche, aber auch erfundene Gräueltaten über Rotarmisten verbreitet und damit den Kampfwillen ein letztes Mal angeheizt. "Auch die Furcht vor Rache wegen früherer deutscher Verbrechen im Osten spielte eine Rolle."
Flankenangriff der Wehrmacht überrascht die Polen
Zunächst läuft für die Rote Armee alles wie geplant. Nach Überquerung der Neiße durchbrechen die 52. und die 2. Armee die dünnen deutschen Verteidigungslinien. Abgesehen von kurzzeitig aufflammenden Abwehrversuchen scheint die Wehrmacht zu keinem nennenswerten Widerstand fähig zu sein. Die Ortschaften Muskau und Rothenburg werden überrannt, Weißenberg fällt nach kurzem Kampf.
Am 19. April erreichen sowjetische Truppen Bautzen und kesseln die Stadt ein. Etwa 1200 Verteidiger von Wehrmacht, Volkssturm und Hitlerjugend verschanzen sich auf der Ortenburg, einer mittelalterlichen Burganlage am Spreeufer. Eine Kapitulation der Eingeschlossenen scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
Noch während in Bautzen die Straßenkämpfe toben, machen sich polnische Einheiten auf den Weg nach Dresden. Mit dem hohen Tempo der Angriffsspitze kann die Nachhut nicht Schritt halten und fällt zurück. Dies bleibt auch Gräser nicht verborgen. Der General dirigiert seine Truppen in die Lücke der polnischen Verbände.
Der deutsche Gegenstoß bei Niesky trifft die Polen völlig unvorbereitet. Świerczewski verliert den Überblick und lässt zunächst nur einen Teil seiner Angriffsspitze umkehren, um nicht abgeschnitten zu werden. Doch seinen schlecht ausgebildeten Offizieren unterlaufen taktische Fehler. Die polnischen Truppen geraten in Unordnung und erleiden schwere Verluste. Der Vorstoß auf Dresden gerät damit zur Nebensache.
Während sich Świerczewskis Armee neu organisiert, erspähen deutsche Aufklärungstrupps eine große Ansammlung polnischer Kräfte bei Förstgen und Weigersdorf. Im Eilmarsch beordert Gräser seine Einheiten zu einer weiteren Attacke.
Massaker auf beiden Seiten
"Die Stunde der Rache ist gekommen! In konzentrischen Angriffen werden wir die bolschewistische Soldateska vernichten!", heizt Gräser die Stimmung in seinem Tagesbefehl am 22. April an. "Die Sowjets sind eingekesselt. Vergeltet an ihnen, was sie unserem Volke angetan haben! Jetzt gibt es kein Pardon mehr!"
Gräsers Männer nehmen ihren Befehlshaber beim Wort. In Guttau ermorden deutsche Soldaten Ärzte, Krankenschwestern und die Verwundeten eines polnischen Feldlazaretts, in Horka (damals Wehrkirch) bringen sie 300 polnische Verwundete um. Bei Wuischke tötet ein Feldgendarmerie-Trupp des Panzerkorps "Großdeutschland" in einem Waldstück 80 Unbewaffnete per Kopfschuss. Die Opfer sind sowjetische Gefangene und deutsche Fahnenflüchtige.
"Diese Feldgendarmerie-Einheit handelte entweder auf direkte Anordnung oder zumindest mit Zustimmung Gräsers", sagt Historiker Brenner. "Der Trupp machte sich nicht einmal die Mühe, die Leichen zu verscharren." Massaker gibt es aber nicht nur auf deutscher Seite. Bei Niederkaina richten sowjetische Soldaten etwa 200 Volkssturmleute hin.
Nach den erfolgreichen deutschen Flankenangriffen geraten auch die sowjetischen Angreifer in Bautzen in Bedrängnis. Am 23. April erreichen deutsche Soldaten die Stadt und fallen den Einheiten der 52. Armee in den Rücken. Um nicht selbst eingekesselt zu werden, ziehen sich die letzten Rotarmisten drei Tage später aus der Stadt zurück und weichen nach Norden aus. Zu diesem Zeitpunkt ist auch Weißenberg wieder unter deutscher Kontrolle. Die Schlacht ist damit entschieden - bis Kriegsende bleibt die Region um Bautzen in der Hand der Wehrmacht.
Die Verluste sind beträchtlich. Die 2. polnische Armee und die sowjetische 52. Armee zählen etwa 11.000 Tote und 21.000 Verwundete. Auf deutscher Seite fallen rund 6500 Soldaten, hinzu kommen 9000 Verwundete. Zwei Wochen nach dem Sieg bei Bautzen kapituliert die Wehrmacht bedingungslos. Das Abschlachten ist vorbei.
Der stern ist wie ntv ein Teil von RTL Deutschland.

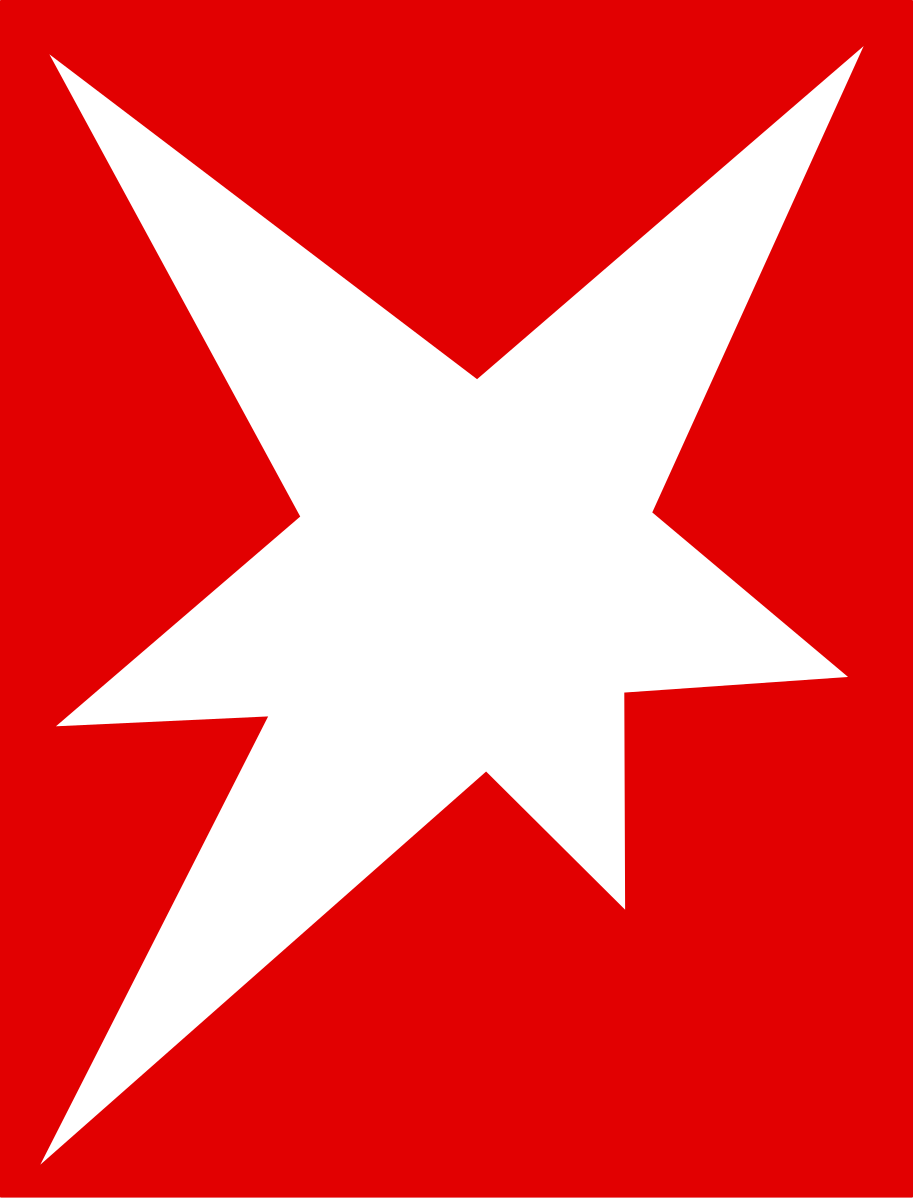 3 hours ago
3 hours ago 





