Dürfen Diebe und Schlägerinnen, Mörder und Betrügerinnen zur Bundestagswahl? Rund 43.000 Menschen sitzen in deutschen Gefängnissen. Wie werden sie an der Abstimmung beteiligt?
Das Bundeswahlgesetz ist eindeutig: "Wahlberechtigt sind alle Deutschen (...), die am Wahltage das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben (...)" Millionen werden am 23. Februar in die Wahllokale gehen, um einen neuen Bundestag zu wählen. Zehntausenden Wahlberechtigten aber wird dieser Weg durch Zellentüren und hohe Mauern verwehrt bleiben – sie sitzen im Gefängnis. Können sie dann überhaupt wählen – und wie läuft das ab?
Bundestagswahl in deutschen Gefängnissen
Grundsätzlich dürfen auch die Insassen in deutschen Justizvollzugsanstalten (JVA) an der Bundestagswahl teilnehmen, vorausgesetzt, sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft und sind volljährig. Zum Stichtag 1. März 2024 saßen rund 43.000 Erwachsene hierzulande im Gefängnis, knapp 26.000 davon waren Deutsche.
Um ihnen die Stimmabgabe zu ermöglichen, gibt es drei Varianten:
- Die zuständige Gemeinde kann für die JVA laut Bundeswahlgesetz einen Sonderwahlbezirk einrichten. In diesem Fall würde hinter den Gefängnismauern ein Wahllokal eingerichtet, um die Inhaftierten an der Wahl teilnehmen zu lassen. Dieses Verfahren ist zum Beispiel auch für Seniorenwohnanlagen möglich. In der Praxis wird in deutschen Gefängnissen aber so gut wie nie davon Gebrauch gemacht.
- Stattdessen haben die Gefangenen – wie auch alle anderen Wahlberechtigten – die Möglichkeit, per Briefwahl an der Bundestagswahl teilzunehmen, wie unter anderem das Justizministerium von Mecklenburg-Vorpommern erklärt. Die Inhaftierten erhalten den Stimmzettel in diesem Fall auf Antrag per Post in die Haftanstalt, machen dort ihre Kreuze und schicken die Wahlunterlagen dann an die zuständige Wahlstelle.
- Wem Hafterleichterungen gewährt wurden, kann seine Stimme am Wahlsonntag auch im Rahmen eines erlaubten Freigangs oder des offenen Vollzugs direkt im Wahllokal abgeben.
Allerdings gibt es auch eine überschaubare Anzahl an Gefangenen, die zwar deutsch und volljährig sind – und trotzdem nicht wählen dürfen. Wer wegen einer politischen Straftat (zum Beispiel Hochverrat, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Abgeordnetenbestechung) verurteilt wurde, kann durch Richterspruch das aktive Wahlrecht verlieren.
Quellen: Bundeswahlleiterin, Bundeswahlgesetz, Statistisches Bundesamt, Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
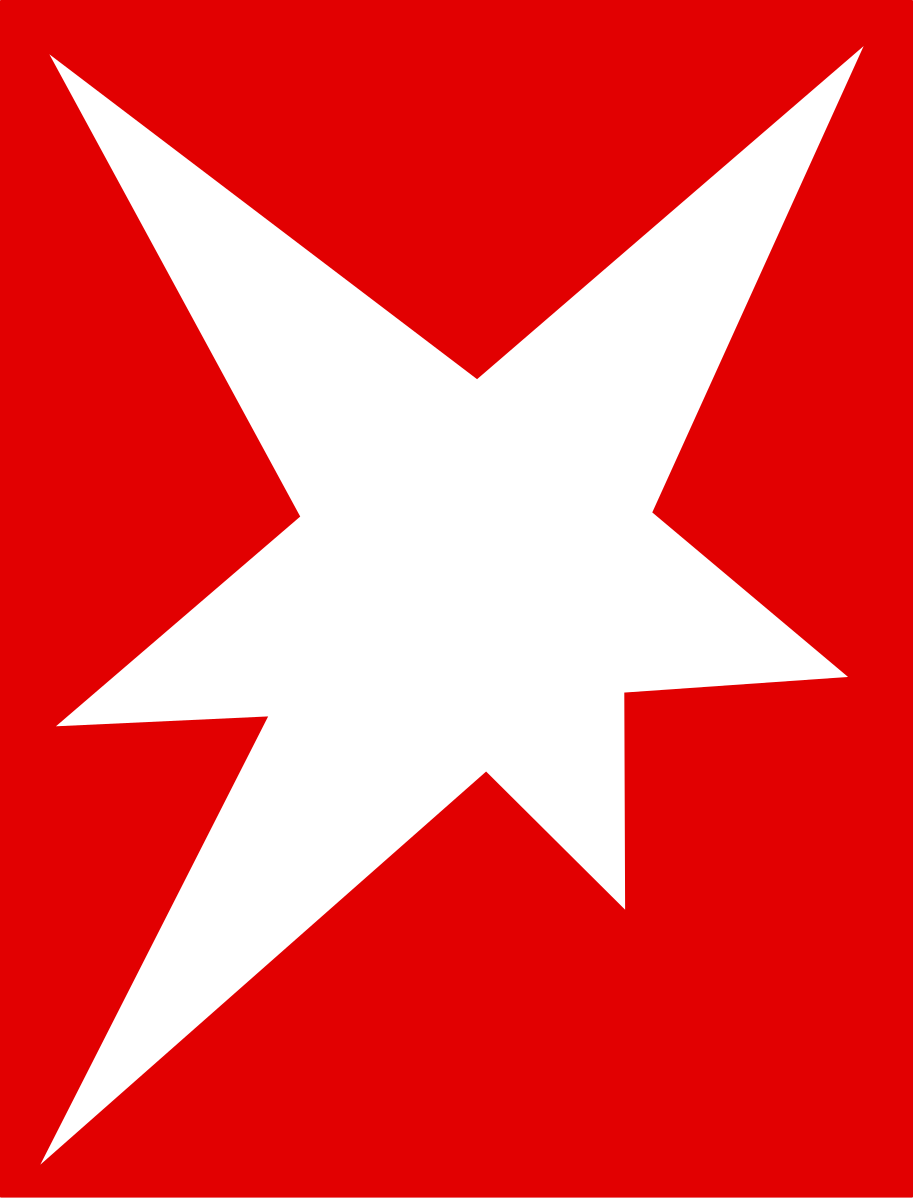 3 hours ago
3 hours ago








