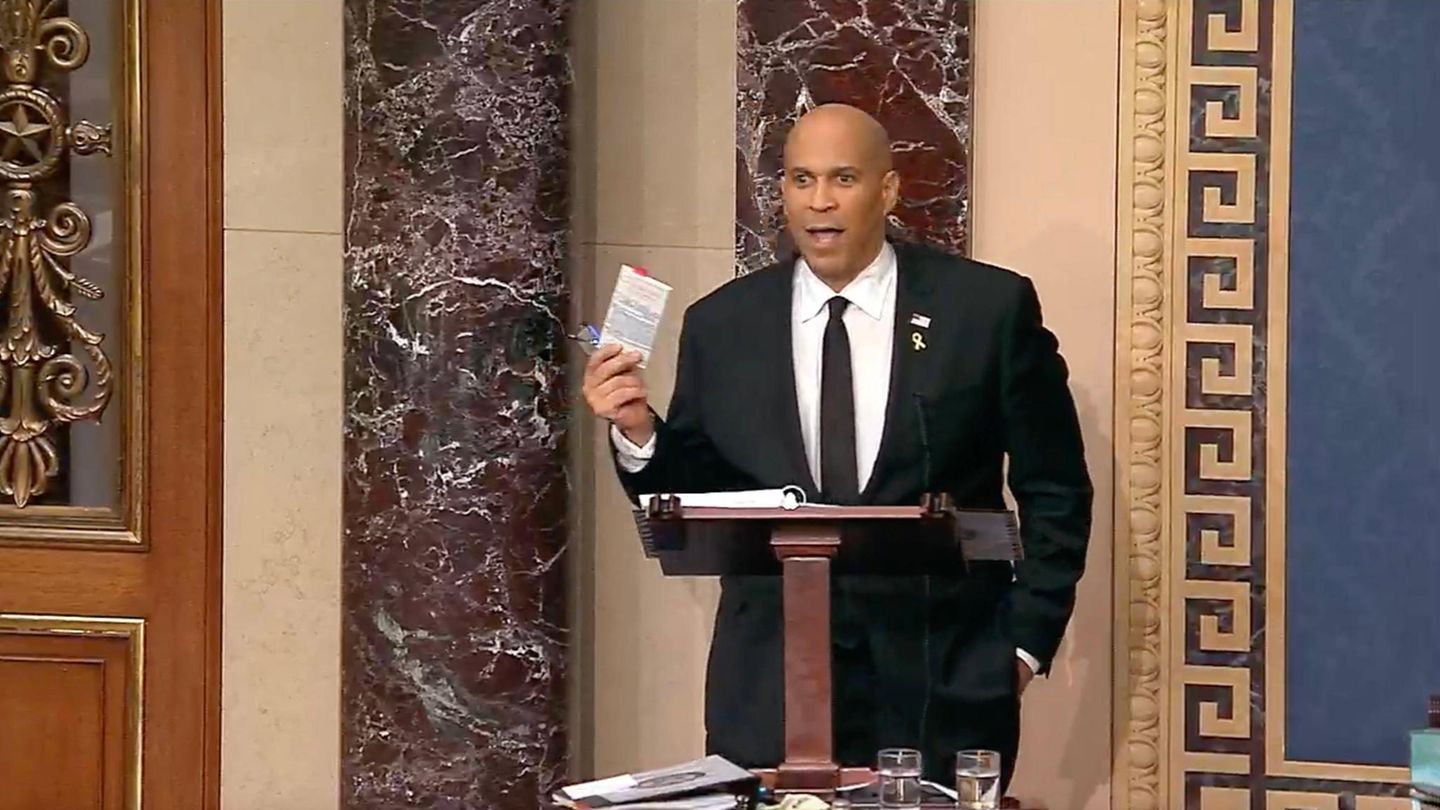Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Doch angesichts der Rekrutierungsprobleme bei der Bundeswehr und der deutlich verschärften Bedrohungslage seit Russlands Angriff auf die Ukraine gewinnt die Diskussion um neue Dienstmodelle an Fahrt. Union und SPD wollen sich in ihren Koalitionsverhandlungen auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen – ihre Vorstellungen liegen aber deutlich auseinander.
Warum braucht die Bundeswehr mehr Personal?
Im Kern geht es um die Verteidigungsfähigkeit des Landes. Die Stärke der Truppe liegt seit Jahren unter dem Soll von 203.300 Soldatinnen und Soldaten in Friedenszeiten. Derzeit sind es knapp 183.000. Es melden sich einfach nicht genügend qualifizierte Freiwillige. Das Verteidigungsministerium verweist darauf, dass zur Bündnisverteidigung innerhalb der Nato zwischen 370.000 und 460.000 Soldatinnen und Soldaten notwendig wären.
Durch mehr als ein Jahrzehnt ohne Wehrdienst fehlt es nicht nur an Personal und Reservisten: Es fehlt auch eine Wehrerfassung - also verlässliche Personaldaten zu wehrfähigen Bürgerinnen und Bürgern. Zudem fehlt es in den Kasernen an Kapazitäten zur Unterbringung von mehr Personal, und es fehlt an Ausbildern.
Über welche Modelle diskutieren Union und SPD?
Die Frage des Wehrdiensts zählt zu den schwierigsten Themen der Koalitionsverhandlungen, in den Arbeitsgruppen der Unterhändler gab es dazu keine Einigung. Die Union hat die Forderung nach einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in das Ergebnispapier der Arbeitsgruppe schreiben lassen. Ohne eine solche Verpflichtung lasse sich die Verteidigungsfähigkeit nicht gewährleisten, argumentiert sie.
Die SPD plädiert hingegen für einen auf Freiwilligkeit basierenden "neuen Wehrdienst" - und verweist auf den bereits vorliegenden Vorschlag von Verteidigungsminister Boris Pistorius. Sein Gesetzentwurf wurde im November bereits vom Kabinett beschlossen, wegen der Neuwahl aber nicht mehr umgesetzt.
Was beinhaltet das Modell von Pistorius?
Alle jungen Männer ab 18 Jahren werden angeschrieben und müssen verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen. Die Fragen betreffen die Bereitschaft, Dienst an der Waffe zu tun, sowie Selbsteinschätzungen zu Fitness und Qualifikationen. Frauen erhalten auch den Fragebogen, sind aber nicht zur Antwort verpflichtet.
Die Bundeswehr lädt dann geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zur Musterung ein. Wer für tauglich befunden wird, soll bei der Bundeswehr dienen - aber nur, wenn er will. Dieses Modell enthalte "einen leichten Zwang" und "ein bisschen Pflicht" - so drückte es die Wehrbeauftragte Eva Högl aus, die für die Umsetzung des Vorschlags warb.
Wo liegen hier Probleme?
Bei der von der Union geforderten Rückkehr zur Wehrpflicht beschränkt das Grundgesetz die Verpflichtung zum Dienst in den Streitkräften in Artikel 12a ausdrücklich auf Männer. Eine solche Ungleichbehandlung erscheint vielen heute nicht mehr zeitgemäß. Für eine Angleichung müsste aber das Grundgesetz geändert werden - angesichts der Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag ist dies unwahrscheinlich.
Ein weiteres Problem liegt bei allen Vorschlägen in den begrenzten Aufnahmekapazitäten der Bundeswehr. Pistorius' Gesetzentwurf nennt als Ziel zunächst nur 5000 zusätzliche Rekruten pro Jahr.
Welche Vorschläge gibt es sonst noch?
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schaltete sich in dieser Woche in die Debatte ein: Er warb für sein Modell einer sozialen Pflichtzeit, die er bereits zu Beginn seiner zweiten Amtszeit vorgestellt hatte. Die Pflichtzeit sei "praktischer Einsatz für die Demokratie und für eine lebenswerte Zukunft", sagte er dem "Stern".
Die von Steinmeier empfohlene Pflichtzeit soll nicht nur im Verteidigungsbereich abgeleistet werden können, sondern etwa auch im Sozialbereich, in der Kultur oder für die Umwelt. Ein ähnliches Modell, der verpflichtende "Freiheitsdienst", wurde kürzlich von Grünen-Politikern vorgestellt. Demnach sollen alle Frauen und Männer irgendwann im Alter zwischen 18 und 67 Jahren sechs Monate Dienst leisten - bei der Bundeswehr oder bei sozialen Organisationen.