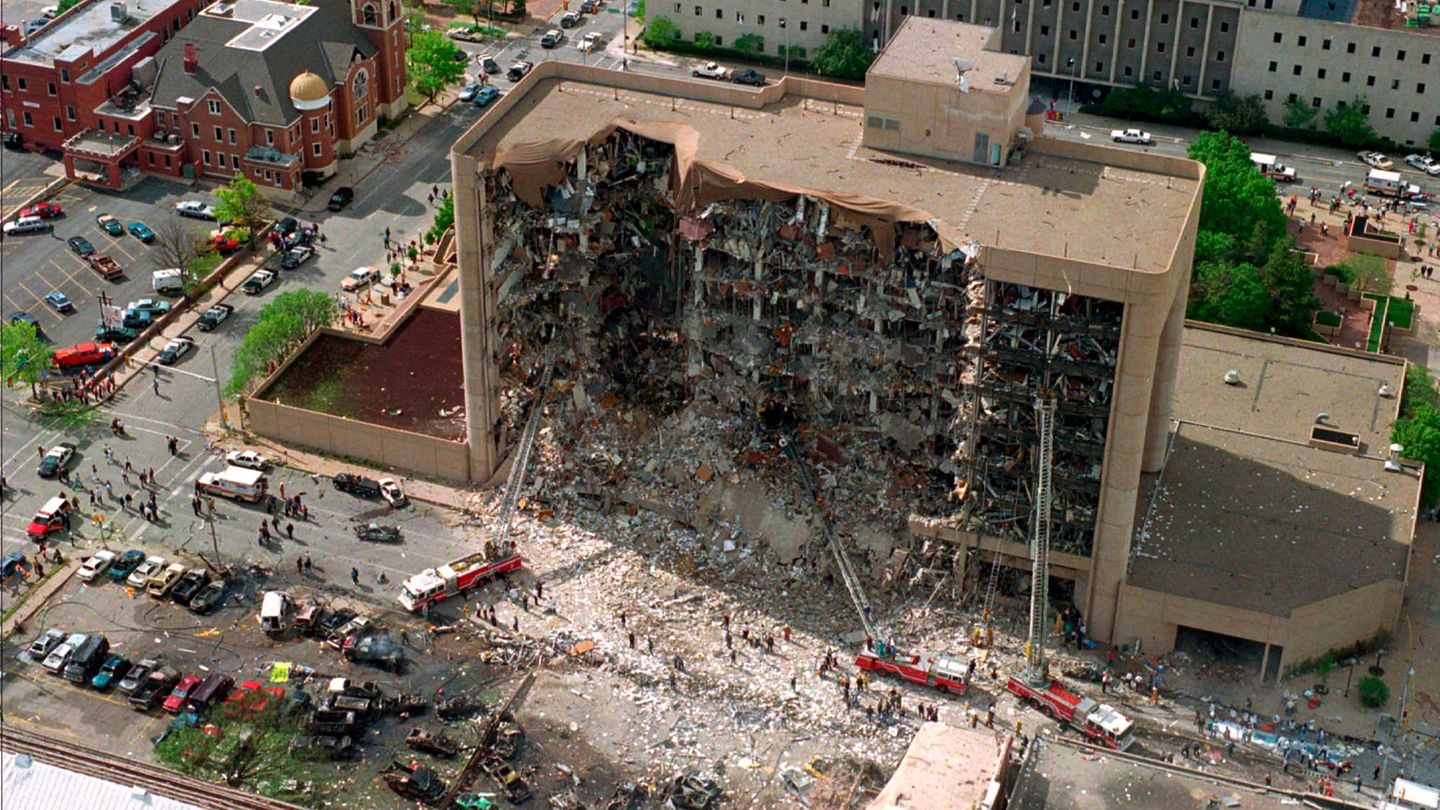Nach den Sondierungen geht die Passage beinahe unter: Union und SPD vereinbaren, den "Beibringungsgrundsatz" ins Asylrecht zu hieven - was einen grundlegenden Systemwechsel bedeutet. Experten fürchten nicht nur weltfremde Ergebnisse vor Gericht, sondern auch den Bruch von Verfassungs- und EU-Recht.
Ein Satz so unscheinbar und sperrig, als lege er es darauf an, überlesen zu werden: "Aus dem Amtsermittlungsgrundsatz muss im Asylrecht der Beibringungsgrundsatz werden", schreiben Union und SPD in ihrem Sondierungspapier. Die Passage kommt ohne Kontext daher und wird nicht weiter erklärt. Zwischen viel diskutierten Schlagwörtern wie "Zurückweisung", "Ausreisearrest" oder "Abschiebung" wirkt sie wie das Kleingedruckte, die reinen Formalien nach dem eigentlichen Vertragstext. Allerdings steckt der Teufel eben häufig im Detail. Der Teufel oder - wie in diesem Fall - der grundlegende Systemwechsel im Asylrecht.
"Diese seltsame Idee hatte bisher noch niemand", sagt Winfried Kluth, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration, im Gespräch mit ntv.de. Offenbar aus gutem Grund: Den Beibringungsgrundsatz ins Asylrecht zu hieven, würde nicht nur mit dem grundlegenden System des Verwaltungsverfahrens brechen, wie der Verfassungsrechtler deutlich macht. "Auch tragende Säulen des Rechtsstaates kämen ins Schwanken." Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht im Deutschen Anwaltverein, Thomas Oberhäuser, sagt dazu bei ntv.de: "Wer solche Vorschläge einbringt, der hat sich noch nie mit Asylrecht beschäftigt, geschweige denn einen einzigen Asylbewerber erlebt."
Der Beibringungsgrundsatz ist eine Verfahrensregel aus dem Zivilrecht. Er bedeutet, dass im Gerichtsverfahren nur über Tatsachen gesprochen und entschieden wird, die von den Parteien selbst ins Verfahren eingebracht werden. Wer etwa nach einem Verkehrsunfall Schadensersatz einklagen will, muss den Schaden an seinem Auto selbst beweisen. Im Gegensatz dazu steht der Amtsermittlungsgrundsatz, der in Verwaltungs-, also auch Asylverfahren zum Tragen kommt: Die Behörden sind - von Amts wegen - verpflichtet, alle für das Verfahren relevanten Informationen zu ermitteln und zu berücksichtigen. Sowohl das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) als auch die Verwaltungsgerichte müssen also alles, was für und gegen einen Asylbescheid spricht, zusammentragen und würdigen.
"Asylsuchende sind Hauptinformationsquelle"
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Anders als in Zivilprozessen steht der Asylsuchende der Macht des Staates gegenüber. Ein offensichtliches Ungleichgewicht an Kapazitäten. Das soll durch die Prinzipien des Rechtsstaates ausgeglichen werden - etwa, dass sich die Verwaltung an Recht und Gesetz halten muss. "Das heißt auch, dass staatliche Maßnahmen, zum Beispiel der Asylbescheid, objektiv richtig sein und nicht bloß den Interessen einer Partei entsprechen muss. Sie dürfen nicht im Widerspruch zu einem Gesetz stehen", erklärt Kluth. In genau diese Kerbe schlägt der Grundsatz, alles Wesentliche mit den weitreichenden Mitteln des Staates zu ermitteln.
Das bedeutet jedoch keineswegs, dass sich Asylsuchende zurücklehnen können, wie Kluth deutlich macht. So sieht das Gesetz gerade für Asylverfahren schon jetzt umfangreiche Mitwirkungspflichten vor. "Das ergibt sich schon daraus, dass der Asylsuchende die Hauptinformationsquelle für die Behörde ist. Diese kann eben nicht erraten, ob und inwieweit der Antragsteller persönlich in seinem Heimatland verfolgt wird." Allerdings, wendet Kluth ein, bleibe den Behörden noch viel Raum für eigene Ermittlungen, etwa die Auswertung von Berichten des Auswärtigen Amtes, um die generelle Gefahrenlage im Herkunftsland zu bestimmen.
Genau das würde künftig jedoch wegfallen. "Zu Lasten des Antragstellers", wie Kluth mahnt. Der müsste künftig selbst beweisen, dass etwa ein menschenwürdiges Leben im Heimatland unmöglich ist oder eine bestimmte religiöse Minderheit auf eine bestimmte Weise unterdrückt wird. "Diese Umstände sind generell nur sehr schwer zu belegen", sagt Knuth. "Den Antragsteller würde das schlicht überfordern."
"Entscheide selbst, was du uns erzählst"
Zumal die Asylsuchenden - ohne Sprach- und Rechtskenntnisse - überhaupt nicht wissen können, welche Informationen für den Richter relevant sind und welche nicht, betont Migrationsrechtler Oberhäuser. Auch das müssten sie künftig selbst entscheiden, sollte das schwarz-rote Vorhaben Realität werden. "Anstatt durch Nachfragen geleitet zu werden, hieße es in Zukunft: Entscheide selbst, was du uns erzählst." Am Ende, so der Experte, stelle dies nicht nur die Asylsuchenden vor kaum lösbare Probleme. "Das ganze System droht ins Chaos zu stürzen."
Man stelle sich einen Homosexuellen aus Uganda vor, der in Deutschland Asyl beantragt, sagt Oberhäuser. Der könne durch entsprechende Gesetzespassagen vielleicht noch glaubhaft belegen, dass homosexuelle Handlungen strafbar sind. "Aber was genau fällt denn alles unter homosexuelle Handlungen? Reicht es aus, Händchen zu halten oder muss man sich küssen? Und wie lautet die Spruchpraxis der ugandischen Richter dazu?" Um eine rechtmäßige Entscheidung zu treffen, Flüchtlingsschutz zu gewähren oder eben nicht, muss sich der Richter von all dem überzeugen. "Mit dem Vorhaben aus dem Sondierungspapier wären ihm allerdings weitgehend die Hände gebunden."
Damit schaffe Schwarz-Rot vor allem eine Zwangslage für die Gerichte. Es müsste Asylsuchende anhören, ohne nachbohren zu dürfen, wenn ihm relevante Informationen fehlen. "Im Grunde müsste es darauf setzen, dass ihm alles Wichtige erzählt wird", sagt Oberhäuser. "Das ist nicht nur weltfremd und führt ins Leere. Das widerspricht auch so ziemlich allem, wofür Verwaltungsgerichte stehen."
Effizienzsteigerung - "auf Kosten des Rechtsstaats"
Stellt sich die Frage, welchen Zweck Union und SPD mit der Passage im Sondierungspapier verfolgen. Auf Nachfrage von ntv.de verweisen sowohl Unions- als auch SPD-Fraktion auf "Stillschweigen" während der derzeitigen Koalitionsverhandlungen. Die Abschaffung der Amtsermittlung könne "in der Praxis die Verfahren beschleunigen", argumentiert der Migrationsrechtler Daniel Thym in der "Süddeutschen Zeitung". Tatsächlich dürften durch einen Systemwechsel viele Asylgesuche schneller abgewiesen werden: "Wer nicht alle Voraussetzungen des Asylanspruchs belegen kann oder sie im Zweifel nicht einmal kennt, hat eben einen unschlüssigen Antrag", erklärt Verfassungsrechtler Kluth. "Natürlich verkürzt das den Prozess - aber eben auf Kosten des Rechtsstaates."
Wenn der Asylbescheid ausschließlich vom Vortrag des Antragstellers abhängt, steht und fällt er mit dessen persönlichen Fähigkeiten und Mitteln. Das habe erstens "nicht mehr viel mit Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, also dem Prinzip der Tatsachen als Entscheidungsgrundlage zu tun", sagt Kluth. Es verletzte auch den Grundsatz der Gleichheit im Verwaltungsverfahren, wonach Personen in vergleichbaren Situationen und Sachverhalten gleich zu behandeln sind - unabhängig von der Fähigkeit, dies vortragen zu können. "Gerade dem sollte im humanitär geprägten Asylrecht doch besonders viel Bedeutung zukommen."
Vor allem aber sei das Vorhaben ein Einfallstor für Willkür. So müssen die Behörden offenkundige Tatsachen, etwa den Krieg in der Ukraine oder den bis 2024 vorherrschenden Bürgerkrieg in Syrien, durchaus weiterhin berücksichtigen, erklärt der Experte. Der Systemwechsel hätte folglich vor allem für jene Menschen einen Nachteil, die aus Ländern oder Lebenslagen kommen, die bisher wenig oder kontrovers dokumentiert sind. "Sie müssten viel größeren Aufwand betreiben, um die Gefahrenlage zu beweisen", so Kluth. In anderen Worten: Sie hätten im Verwaltungsverfahren - zufällig - eine schlechtere Stellung als andere Asylbewerber. "Das nennen wir Willkür - den schlimmsten Verstoß gegen den Rechtsstaat."
"Ohnehin europarechtswidrig"
Schließlich würde der radikale Systemwechsel im Asylprozess auch das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz gefährden, wie Migrationsrechtler Oberhäuser deutlich macht. So steht plötzlich jemand vor Gericht, der nicht anwaltlich vertreten ist, der weder Sprache noch Rechtssystem versteht und der keine finanziellen Ressourcen hat. Ihm gegenüber sitzt das genaue Gegenteil - eine Bundesbehörde mit enorm viel Fach- und Sachkompetenz. "Wenn das Gericht aber nicht mehr von Amts wegen ermitteln darf, wie schwer dürfte es dem BAMF dann noch fallen, den Richter davon zu überzeugen, dass die Schwelle für die Bestrafungen homosexueller Handlungen in Uganda weitaus höher ist als der Asylsuchende behauptet?", so der Experte. Einen Amtsermittlungsgrundsatz, der diese Waffenungleichheit ausgleichen soll, gäbe es nicht mehr.
"Damit ist das Vorhaben ohnehin europarechtswidrig", sagt Oberhäuser. Zwar verpflichte auch das EU-Recht den Betroffenen, wichtige Informationen zu seinem Asylantrag vorzutragen. "Aber klargestellt ist auch, dass Behörden und Gerichte nicht davon befreit sind, alle relevanten Umstände zu sammeln und eine Gesamtwürdigung vorzunehmen." Verwaltungsgerichte dürften das schwarz-rote Vorhaben also nicht einmal umsetzen. Denn: EU-Recht geht vor.
Spätestens an diesem Punkt zeige sich, dass die Idee des Systemwechsels im Asylrecht "von Anfang an eine Kopfgeburt" war, sagt Oberhäuser. Es spreche nichts dagegen, zu überlegen, wie die Effizienz von Justiz und Verwaltung über juristische Stellschrauben gesteigert werden kann. "Dabei aber geltendes Recht zu ignorieren, verschiebt die Grenzen in eine gefährliche Richtung." "Ehrlich gesagt", so der Experte, "ist der Vorschlag im Sondierungspapier absurd".