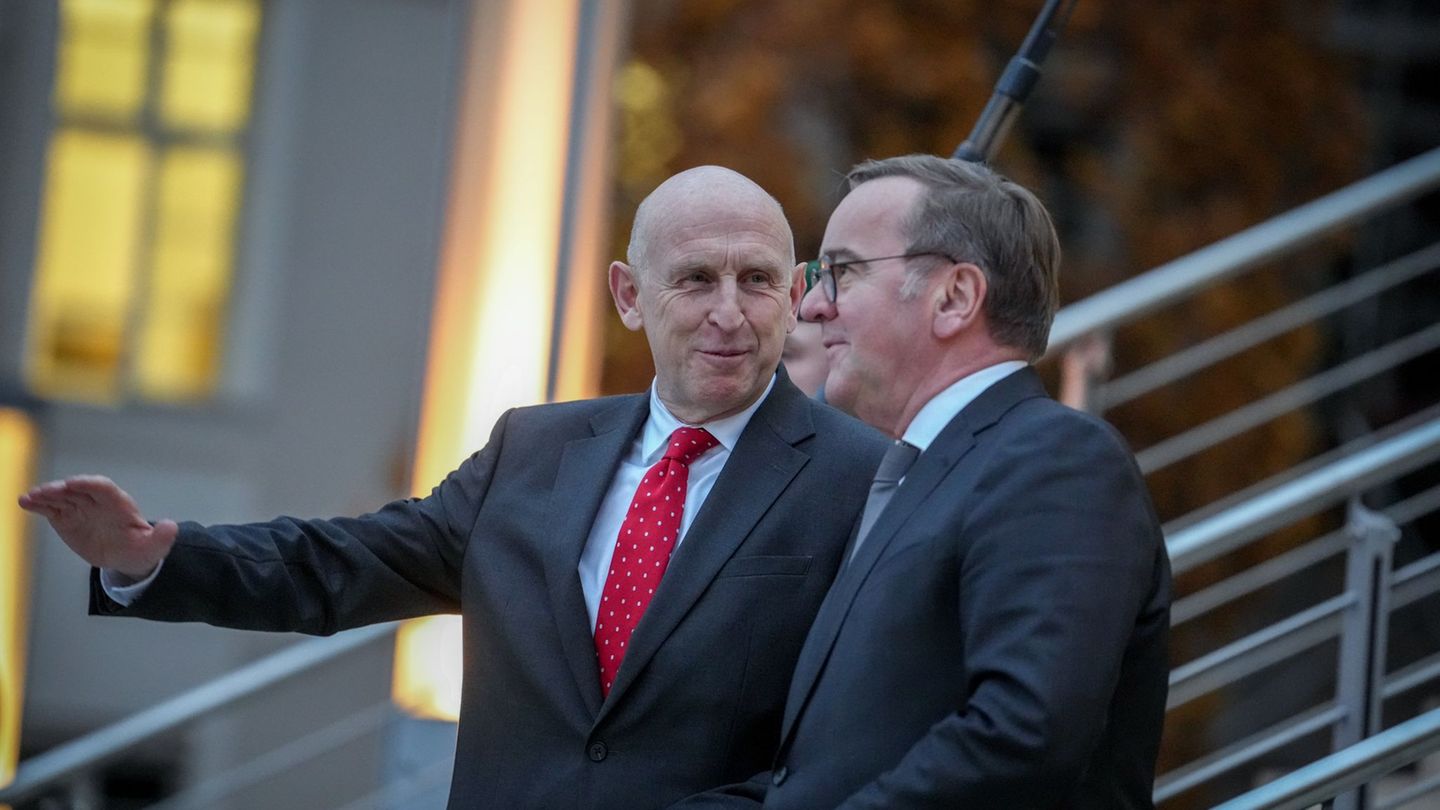Der türkische Staatspräsident lässt die Maske des Demokraten endgültig fallen. Die Verhaftung seines populären Kontrahenten mitsamt Hunderten von Oppositionellen wirkt wie ein Putschversuch in Zivil. Doch Erdogan unterschätzt zwei überraschende Widerstandskräfte.
Mit der Inhaftierung des Oppositionsführers Ekrem İmamoğlu setzt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine Republik in Brand. Auf Massenproteste folgt eine Verhaftungswelle, schon mehr als 1000 Oppositionelle wurden festgenommen, viele sind durch Polizeigewalt und Gummigeschossen verletzt. Millionen von Türken spüren, dass Erdoğan nicht mehr und nicht weniger versucht als einen Staatsstreich. İmamoğlu lässt über seine Anwälte verbreiten, Erdoğan habe den "politischen Putsch" gestartet. "Ich rufe mein Volk auf: Mit eurer Unterstützung werden wir zuerst diesen Putsch vereiteln, und dann werden wir diejenigen fortschicken, die uns dies erleben ließen."


Demonstrierende bezeichnen Erdoğan als "Diplom-Jäger", weil İmamoğlu der Universitätsabschluss aberkannt wurde - und ohne Diplom keine Präsidentschaftskandidatur.
(Foto: REUTERS)
Tatsächlich setzt Erdoğan auf Eskalation. Gezielt verbreitet er Angst und will Oppositionelle einschüchtern. Wenn der regierende Bürgermeister von Istanbul aus schierer Willkür im Gefängnis landen kann, dann kann das jedem auf Erdoğans Geheiß passieren. Erdoğan will - in bester Despotenmanier - mit Polizeigewalt und Justizwillkür abschrecken. So verurteilt er die weitestgehend friedlichen Proteste als "eine Gewaltbewegung". Die Protestler seien "Straßenterroristen", sie würden "zur Rechenschaft gezogen". Damit bereitet er die nächste Stufe der Repression vor.
Das Muster, durch die Verhaftung des größten politischen Gegners die eigene Despotie zu festigen, ist geschichtsnotorisch. Als Antonius seinen Widersacher Cicero verhaften und ermorden ließ, war die römische Demokratie am Ende. Als Robespierre seinen Konkurrenten Danton verhaften ließ, war die Terrorherrschaft der Französischen Revolution entfesselt. Als Josef Stalin Leo Trotzki verdrängte, begann die Sowjetdiktatur in ihrer ganzen Brutalität.
Der Sultan klammert sich an sein Amt
Erdoğan hat die Türkei in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt in eine Autokratie verwandelt. Seine Macht vergrößerte er im Präsidialsystem systematisch, Medien und Justiz wurden zusehends auf Linie gebracht. Die Gewaltenteilung leidet. Nun plant Erdoğan offenbar eine Verfassungsänderung, um eine Wiederwahl 2028 zu ermöglichen. Noch im Frühjahr 2024 hatte er bei der Kommunalwahl eigentlich von seinem "Finale", seiner letzten Wahl gesprochen und warb "noch einmal" für seine AKP um Unterstützung. Doch Anfang 2025 gab er plötzlich bekannt, 2028 doch wieder antreten zu wollen. Dafür muss er die Verfassung ändern und braucht die kurdische Minderheit. Das gilt als Hauptgrund, warum Erdoğan plötzlich große politische Kompromisse mit der Kurdenpartei sucht und selbst die Begnadigung von PKK-Führer Öcalan in Aussicht stellt. Dass die Verhaftung İmamoğlus ausgerechnet am kurdischen Neujahrstag stattfand, wird ebenfalls als Indiz dafür gewertet, dass Erdoğan den großangelegten Staatsstreich plant.
Offenbar will Erdoğan wie sein politischer Freund und Kreml-Chef Wladimir Putin nach zwei Jahrzehnten an der Macht nun bis an sein Lebensende im Amt bleiben. So wie Putin sich in einer zaristisch-imperialen Tradition sieht, wähnt sich Erdoğan als neo-osmanischer Sultan, der sein Land zurück zur historischen Größe führt.
Angst vor dem Machtverlust
Die Beschuldigungen der Korruption und Terrorunterstützung gegen İmamoğlu gehörten zum "Standardrepertoire, das gegen diejenigen erhoben wird, die für Erdoğan und seine Macht gefährlich werden oder wurden", erklärt der Türkei-Experte Yaşar Aydın von der Stiftung Wissenschaft und Politik im ZDF. Politische Kritiker wie Osman Kavala und Selahattin Demirtaş von der prokurdischen DEM-Partei säßen seit über zehn Jahren in der Türkei in Haft.
Doch die Tatsache, dass Erdoğan es für notwendig erachtet, seinen Herausforderer frühzeitig zu verhaften, zeigt zugleich, dass er Angst um seine Macht hat. Erdoğans Akzeptanz in der türkischen Bevölkerung schwindet seit einiger Zeit zusehends. Die Kommunalwahlen im vergangenen Jahr wurden zum Triumphzug für die CHP. Mit starken Zuwächsen holte die Opposition fast alle Großstädte und gewann überraschend auch in vielen ländlicheren Gegenden. Landesweit landete Erdoğans AKP erstmals nicht auf dem ersten Platz. Erdoğan muss also fürchten, bei den kommenden Wahlen gegen İmamoğlu zu verlieren.
Auslöser für die Erdoğan-Müdigkeit der Türken ist die miserable Wirtschaftslage der Türkei. Die Inflation galoppiert und lässt insbesondere die Kleinverdiener und Rentner leiden, die türkische Lira verliert dramatisch an Wert.
Der Widerstand wächst, die Kurse brechen ein
Doch Erdoğan scheint falsch kalkuliert zu haben, was sein Putschversuch nun auslöst. Zum einen hat er den Widerstand der Massen gegen die Verhaftungswelle offenbar unterschätzt. Viele Türken sind stolz auf die Demokratie und spüren, dass es jetzt um die Verfassung geht. Der breite Widerstand geht weit über die Oppositionspartei hinaus. Auch konservative AKP-Anhänger wollen ihr Land nicht vollends zur Despotie werden lassen.
Zum anderen lösen der Putschversuch und die Unruhen einen Börsenkrach aus, mit einer drohenden Kettenreaktion negativer Folgen. Nicht nur Aktienkurse brechen ein, es schnellen auch die Renditen für Staatsanleihen empor - und damit das ohnedies hohe Zinsniveau. Die Kreditvergabe kommt ins Stocken. Nur Not-Interventionen der Zentralbank und der Börsenaufsicht haben die Märkte einigermaßen stabilisiert. Doch in der Wirtschaft und der türkischen Finanzwelt wächst der Ärger über Erdoğans Putschversuch. Das Leistungsbilanzdefizit der Türkei weitete sich im Januar 2025 bereits auf 3,80 Milliarden US-Dollar aus. Schon im Dezember waren es 4,65 Milliarden US-Dollar Miese - verglichen mit 1,71 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Monat des Vorjahres. Die Abhängigkeit von ausländischem Kapital wächst damit rapide. Doch bei einem Putschversuch bleibt das Kapital aus, eine Abwärtsspirale setzt sich in Gang.
Die Wirtschaftselite hatte lange zu Erdoğan gehalten, jetzt droht er sie zu verlieren. Auch die Studentenschaft ist jetzt massiv gegen Erdoğan mobilisiert. Und viele Privatsparer ebenfalls. Denn viele türkische Privatanleger haben in den vergangenen Jahren den Aktienmarkt genutzt, um ihr Vermögen vor der hohen Inflation zu schützen. Und die lag im Februar 2025 bei 39,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch ein Verfallsindex für Erdoğan.