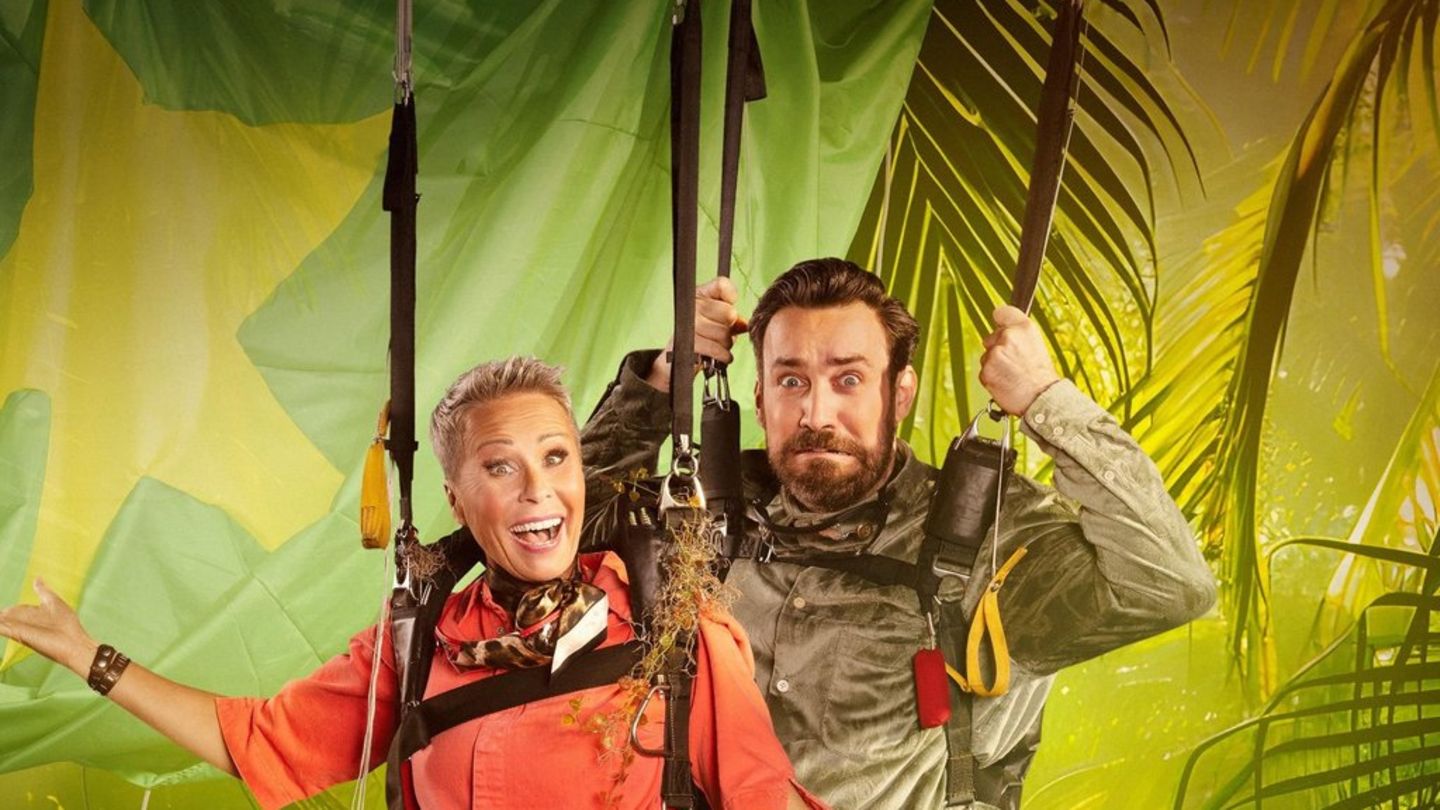Donald Trump wird wieder US-Präsident, mit dieser Realität muss Deutschland umgehen. Dabei erwischt der Ausgang der Wahl das Land auf dem falschen Fuß. Weder politisch noch wirtschaftlich oder in der Verteidigung wirkt die Bundesrepublik vorbereitet.
Tom Nuttal heißt der Deutschland-Korrespondent des "Economist", dem renommierten britischen Wirtschaftsmagazin. Auf X schreibt er nach dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA: "Deutschlands Regierung wird nicht den Tag damit verbringen, eine Antwort auf das Ergebnis zu finden, sich mit Verbündeten beraten und Führung in Europa zeigen. Sie wird den Tag damit verbringen, zu entscheiden, ob sie Harakiri macht."
Damit spielt er auf den Koalitionsausschuss an, der an diesem Mittwoch tagt. Es geht mal wieder um die Frage, ob die Ampelkoalition beisammenbleibt. Vor der Wahl wurde diskutiert, ob ein Sieg Trumps SPD, Grüne und FDP noch einmal zusammenschweißt. Denn, siehe oben, Deutschland werde jetzt als Stabilitätsanker in Europa gebraucht. Doch man kann mit einigem Recht sagen: Der Zug ist sowieso abgefahren und Neuwahlen sind jetzt erst recht notwendig.
Die aktuelle Regierungskrise ist typisch für die deutsche Lage. Überall ist Krise. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Verteidigung. Vom Klima ganz zu schweigen. Deutschland steht neben sich. Fairerweise ist das nicht nur der Ampelkoalition anzulasten. Inflation nach der Pandemie, der russische Angriffskrieg, die Aufnahme von Hunderttausenden Ukrainern, die hohen Energiepreise: Das hat diese Regierung nicht bestellt. Hier und da hätte man Dinge anders machen können, etwa die Atomkraftwerke am Netz lassen. Umgekehrt war es gut, den Ausbau der erneuerbaren Energien endlich zu beschleunigen. Aber die Ausgangslage bleibt so oder so schwierig.
Bestellte Führung kam nicht
Diese Regierung ist allerdings nicht mehr in der Lage, eine ihrer wichtigen Aufgaben zu erfüllen: Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung auf bessere Zeiten zu wecken. Denn sie tritt nicht geschlossen auf. Da richten sich die Blicke zunächst auf den Bundeskanzler. Olaf Scholz ist Regierungschef und unter seiner Ägide macht jede und jeder, was sie oder er will. Vielleicht kann man einen Christian Lindner und einen Robert Habeck gar nicht einhegen. Aber sein Versprechen "Wer Führung bestellt, bekommt Führung" hat der Kanzler nicht eingelöst.
Das gilt leider auch für die Europäische Union. Denn die ist die Antwort auf viele Probleme Deutschlands. Alleine ist Deutschland international ein Zwerg, aber die EU hat Gewicht. In Handelsfragen vor allem, und das ist nicht wenig. Tritt die EU gemeinsam gegenüber Trump oder China auf, macht das Eindruck. Europa zusammenzuhalten, ist daher auch eine der obersten Aufgaben eines jeden Bundeskanzlers. Doch bei Scholz ist davon wenig zu spüren. Eine gemeinsame, kraftvolle Haltung zur Ukraine beispielsweise ist nicht zu erkennen. Der deutsch-französische Motor stottert schon lange. Wird die EU so die Kraft aufbringen, einen Block gegenüber Trump zu bilden? Das ist zumindest sehr offen.
Auch die Wirtschaft ist in der Krise. Im zweiten Jahr ist sie in der Rezession. Gründe sind die hohen Energiepreise, aber auch die Konjunkturschwäche in China. So etwas kann keine Bundesregierung mit einem Fingerschnippen verschwinden lassen. Aber die Ampel findet zu keiner gemeinsamen Linie. Mal fordert Habeck etwas, dann schreibt Lindner wieder ein Papier. Unternehmen brauchen aber Planungssicherheit. Und auch Unternehmer agieren beherzter, wenn sie das Gefühl haben, die Regierung weiß, was sie will. Trump droht mit neuen Zöllen gegen die EU. Europa wirkt in dieser Lage wie das Strohhaus eines kleinen Schweinchens, das der böse Wolf nur umzupusten braucht.
Wie geht es mit der Bundeswehr weiter?
Dann ist da noch das akut bedrohlichste Thema, der Krieg in der Ukraine. Deutschland war nicht untätig, das ist richtig. Das Sondervermögen für die Bundeswehr war ein beherzter Schritt nach vorn. Doch danach kam der Elan dieser Bundesregierung zum Erliegen. Teilweise wurde das Geld aus diesem neuen Schuldentopf entgegen den Versprechungen für den laufenden Betrieb verwendet. Vor allem aber ist unklar, wie es weitergeht, wenn die 100 Milliarden Euro aufgebraucht sind. Das wird Ende 2027 der Fall sein. Dann müsste der Verteidigungshaushalt um rund 30 Milliarden Euro aufwachsen, um das Zwei-Prozent-Ziel der NATO zu erreichen.
Trump wird jedenfalls weiter darauf dringen, vielleicht wird er sogar Verteidigungsausgaben in Höhe von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts fordern. Doch es geht nicht darum, den US-Präsidenten glücklich zu machen. Es geht darum, selbst für die eigene Sicherheit zu sorgen. Da hat der Republikaner gar nicht so unrecht. Warum sollten die USA die Europäer für alle Zeiten vor Russland beschützen? Auf der Münchener Sicherheitskonferenz fragte der künftige Vizepräsident J. D. Vance: "Wenn die Ukraine so wichtig ist, warum tut Europa dann nicht mehr?"
Währenddessen baut Russland 1500 Panzer im Jahr. Doppelt so viele, wie die fünf größten europäischen NATO-Staaten im Bestand haben. Wenn Trump tatsächlich die Ukraine fallen lässt, wird die folgende Situation ein Problem Europas sein. Insofern war es gut, dass Scholz die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland vorangetrieben hat. Schon jetzt wankt die Front in der Ukraine bedenklich. Jeden Tag marschieren die Russen einige Kilometer voran. Der Ukraine gehen die Soldaten aus.
Arbeitet Scholz hinter den Kulissen daran? Vor den Kulissen ist jedenfalls nicht viel davon zu sehen. Vor den Kulissen fraternisiert die SPD in Brandenburg mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Das BSW war einer der großen Gewinner der Landtagswahlen in Ostdeutschland. Der andere war die AfD. Übrigens die Partei, die sich über Trumps Wahlsieg freut. Die nächsten vier Jahre werden jedenfalls interessant. "Mögest du in interessanten Zeiten leben", ist ein Spruch aus der chinesischen Sprache. Er ist als Fluch gemeint.