Weithin unbeachtet sichert sich Friedrich Merz die Macht in der Migrations- und Außenpolitik. Dafür sind nicht Ministernamen entscheidend, sondern die Ressortverteilung.
Im Verborgenen könnte Friedrich Merz bei der Ressortverteilung ein ziemlicher Coup gelungen sein. Und nicht einmal seine Partei scheint das bisher vollumfänglich zu begreifen.
Nein, es geht nicht um die personelle Besetzung der Ministerposten, die nun nach und nach durchsickert. Vielmehr ist die Aufteilung der Ministerien zwischen den Parteien entscheidend. Ausgerechnet in der Migrations- und Außenpolitik könnte diese nämlich wirklich für "CDU pur" sorgen. Merz hat hier auf volle Machtkonzentration gesetzt. Es ist seine große Chance auf schnelle Achtungserfolge.
Kabinett: Warum das Außenministerium so wichtig ist
Der Kanzler in spe wollte von Beginn an unbedingt, dass CDU/CSU das Kanzleramt, das Innenministerium und – gegen jede Tradition – auch das Außenministerium besetzen. Letzteres bekommt normalerweise der Koalitionspartner.
Es war Merz‘ persönlicher Wunsch, dass es diesmal anders kommt, so ist es zu hören. Bei den eigenen Leuten löste das viel Unverständnis aus. Was bringt der Union ein geschwächtes Auswärtiges Amt, wenn Merz die Außenpolitik ohnehin im Kanzleramt bündeln will? Warum wurde nicht stattdessen das Finanz- oder Verteidigungsministerium gewählt?
Dahinter dürften zwei Kerngedanken stecken: Erstens fehlen der SPD jetzt entscheidende Veto-Rechte in der Asyl- und Migrationspolitik. CDU und CSU können neue Regeln nahezu im Alleingang abstimmen und umsetzen. In der alten Koalition hatte insbesondere das Auswärtige Amt unter der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock oft zum Ärger von SPD und FDP Abschiebungen verhindert, Gespräche mit Ländern wie Syrien und Afghanistan verzögert und zugleich sehr freihändig Visa erteilt. Stichwort: freiwillige Aufnahmeprogramme.
Ein konservativer Kamerad an der Seite von Friedrich Merz
Das wird unter dem designierten Außenminister Johann Wadephul anders laufen. Für den CDU-Mann ist die Berufung ein riesiger Karriereschritt. Der 62-Jährige gilt als loyal zu Merz – und gut vernetzt in Europa. Ein Auswärtiges Amt unter seine Führung dürfte nicht wie noch unter Baerbock eine eigene Nebenaußenpolitik machen. Wadephul wird stattdessen häufiger für Merz sondieren, eine Art Vorauskommando bilden. Olaf Scholz hatte es im Auswärtigen Amt mit einer unabhängigen Ex-Kanzlerkandidatin zu tun. Merz kann dort auf einen konservativen Kameraden zählen.
Zweitens kann der Kanzler im besten Fall auch Europapolitik aus einem Guss machen. Denn neben dem Kanzleramt und dem Außenministerium ist auch das dafür mitzuständige Wirtschaftsministerium in schwarzer Hand. So soll vor allem das sogenannte "German Vote" verhindert werden. Deutschland hatte sich in den letzten Jahren in entscheidenden Fragen häufiger kurzfristig enthalten, weil man sich in Berlin nicht einig wurde und so wichtige EU-Projekte ausbremste.
In Brüssel wurde Deutschland so mehr und mehr zur Lachnummer. Und war als Machtfaktor abgemeldet. Das soll in der neuen Regierung schon die Ressortverteilung verhindern. Merz will außerdem ein zusätzliches "EU-Monitoring" im Kanzleramt einführen, um Konflikte schnell zu erkennen. Der ebenfalls neuerdings dort angesiedelte nationale Sicherheitsrat soll die Koordination befördern und beschleunigen.
Friedrich Merz zahlt dafür einen hohen Preis
Ja, der 69-Jährige muss für diese Konzentration der außenpolitischen Macht bei sich und seiner Partei einen hohen Preis zahlen. Die SPD hat künftig die Hand auf dem Finanzressort, bleibt weiterhin Hüterin der wachsenden Sozialausgaben und kann auch die vielen Gelder im Bereich Verteidigung ausgeben. Die CDU muss sich dafür mit Problem-Ressorts wie Gesundheit (Pflege- und Krankenhausreform…) und Verkehr (Deutsche Bahn…) herumschlagen.
Gleichzeitig ist nicht sicher, dass allein die Ressortverteilung politische Probleme auflöst: Gleichzeitig wurde auf Wunsch der CSU die Rolle des Koalitionsausschusses gestärkt, auch die Fraktionen werden eine wichtige Rolle spielen. War es das als wirklich wert? An der Antwort auf diese Frage wird sich Friedrich Merz messen lassen müssen.
Friedrich Merz muss seiner Partei den Preis zurückzahlen
Wenn der von ihm geplante Zuschnitt dazu führt, dass Deutschland wieder zu einem kraftvollen Europa beiträgt, statt die Union auszubremsen. Wenn Deutschland neben Frankreich, Großbritannien und Italien überhaupt wieder eine hörbare Stimme in der Welt wird – ob als Antreiber, Ideengeber oder Vermittler. Wenn zusätzlich endlich eine stringente Migrationspolitik umgesetzt würde; dann könnte diese Strategie aufgehen.
Friedrich Merz hat sich das in den Verhandlungen schön für sich zurechtgelegt, dafür andere Begehrlichkeiten in seiner Partei ignoriert. Bleiben außenpolitische Erfolge aus, könnte sein Aufprall aber umso heftiger sein. Und der Ärger in der Partei allemal.

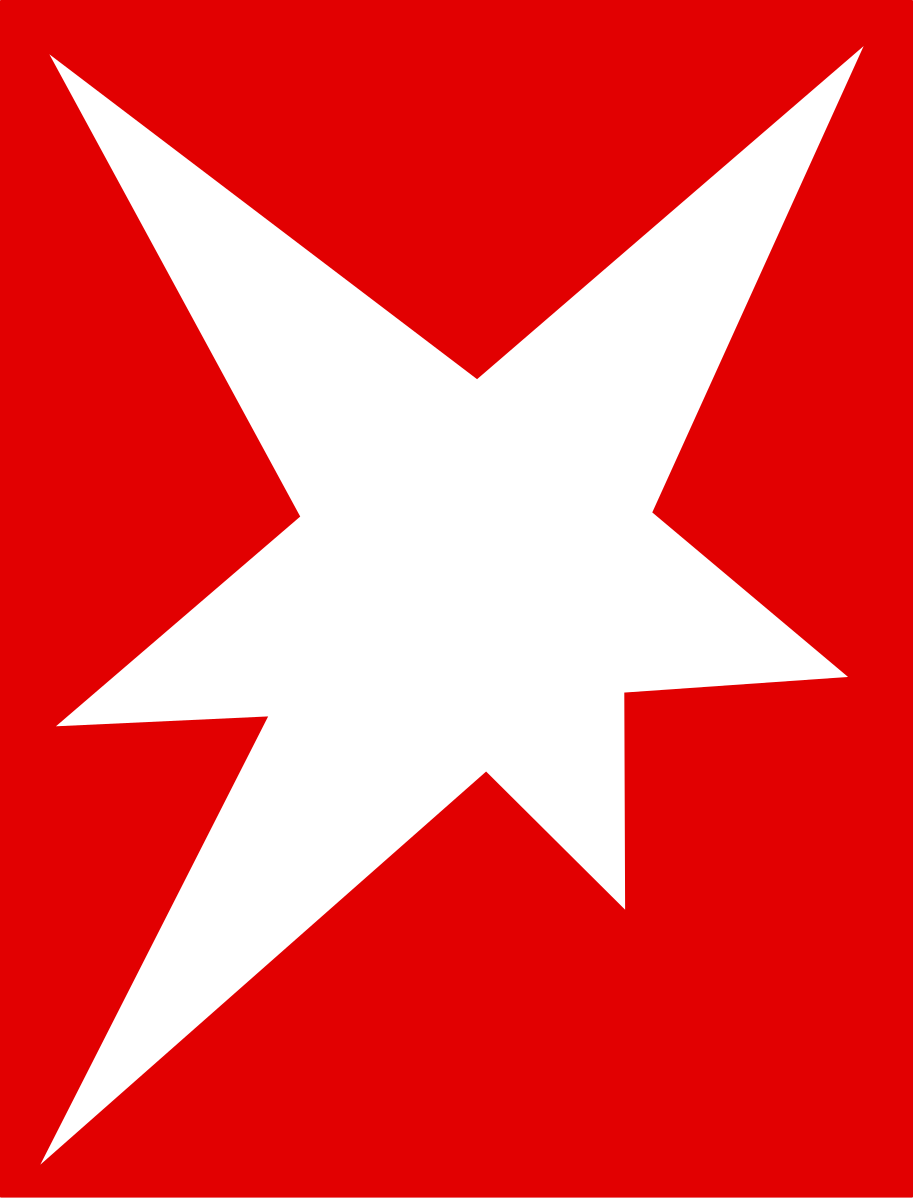 8 hours ago
8 hours ago 





