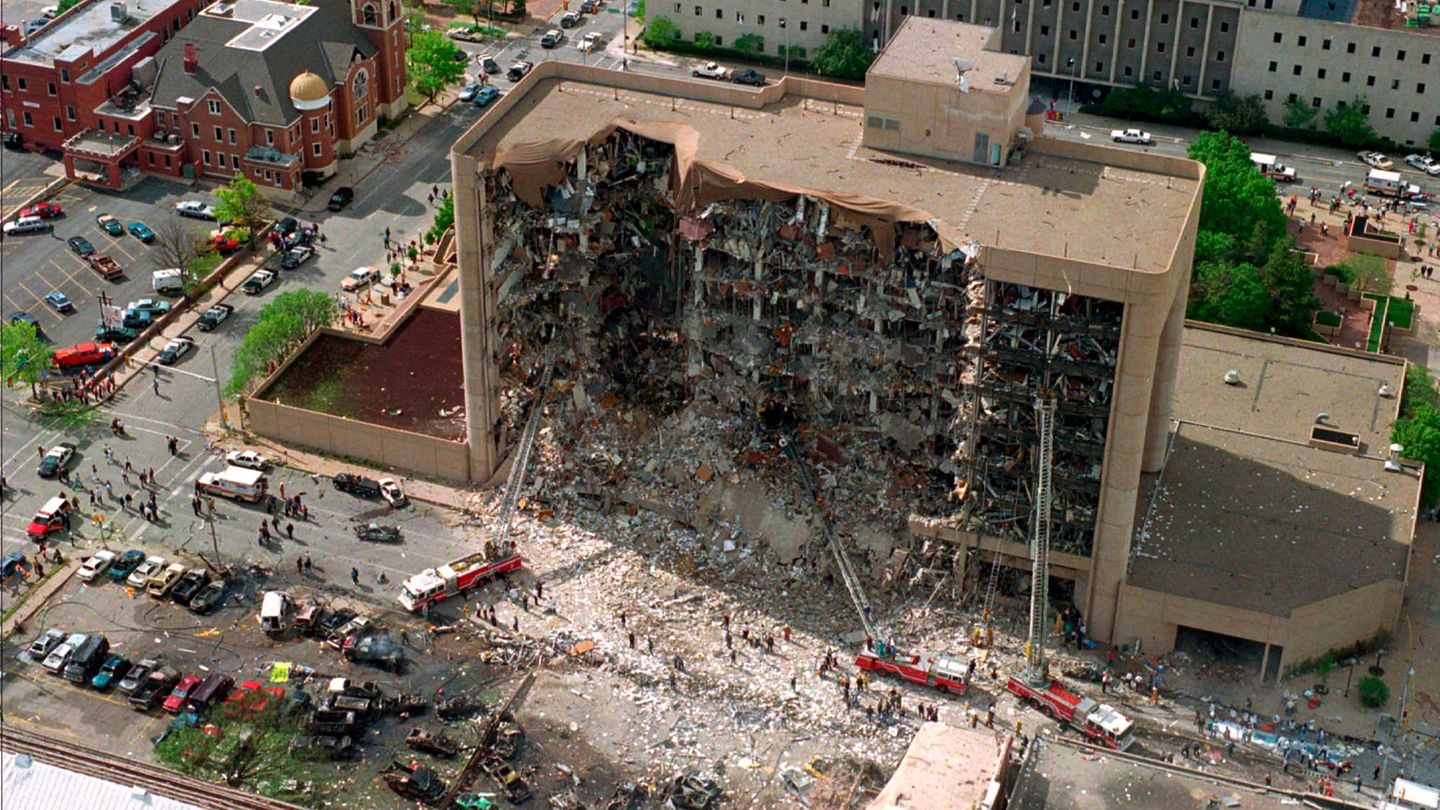"Was für Amateure!", mag sich mancher denken angesichts der Chat-Panne ranghöchster US-Regierungsmitglieder. Doch der Umgang der Trump-Truppe mit dieser Affäre ist beängstigend.
Die ersten zwei Monate von Donald Trumps zweiter Amtszeit als US-Präsident sind eine Aneinanderreihung von skandalösen Äußerungen, Angriffen auf die Rechtsstaatlichkeit, offenkundiger Korruption und schierer Niedertracht. Der Niedergang der USA als Instanz westlicher Werte vollzieht sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Die versehentliche Aufnahme des "Atlantic"-Chefredakteurs Jeffrey Goldberg in eine Chat-Gruppe ranghöchster Trump-Mitstreiter scheint vor diesem Hintergrund nicht mehr als eine amüsante Anekdote zu sein. "Was für Amateure!", mag sich mancher denken und schmunzeln. In Wahrheit aber spiegelt sich in dem Vorgang die ganze kriminelle Energie, mit der Trumps Gefolgsleute sich gerade die älteste Demokratie der Welt Untertan machen.
US-Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Stabschefin Susie Wiles und US-Sicherheitsberater Michael Waltz sowie zwölf weitere Personen der höchsten Regierungsebene tauschten offenkundig hochsensible Informationen und Einschätzungen auf dem Messenger-Dienst Signal aus. Der ist zwar verschlüsselt, aber zählt nicht zu den zertifizierten Kommunikationsplattformen, auf denen US-Regierungsbeamte sensible Informationen austauschen dürfen. Dass die Trump-Truppe dennoch darauf ausweicht, ist leicht zu erklären: Das MAGA-Team (MAGA für "Make America Great Again") hegt eine tiefe Paranoia vor einem deep state. Das Misstrauen gegen die Bundesverwaltung und Justiz ist groß, solange diese nicht vollständig unter eigene Kontrolle gebracht sind.
Kommunikation auf inoffiziellen Kanäle wird nicht wie die sonstige Regierungskommunikation grundsätzlich archiviert. Die Inhalte können entsprechend auch nicht gegen die Akteure verwendet werden, wenn es zu Rechtsverstößen kommt - vorausgesetzt, es liest niemand mit, der eigentlich gar nicht eingeladen war. Chefredakteur Goldberg zum Beispiel, der offenbar aus Unachtsamkeit dem Chat hinzugefügt wurde.
Abstreiten und Diskreditieren
Der Umgang mit dem Auffliegen der Affäre lässt tief blicken, wie immun sich Trump und seine Vasallen inzwischen gegen jede Kritik aus Medien, Opposition und Justiz wähnen. Der einstige Reality-Show-Star Trump und der vormalige Fox-News-Moderator Hegseth streiten die Vorwürfe einfach ab und diskreditieren stattdessen Goldberg und "The Atlantic". Das Magazin genießt anders als etwa Fox News hohes Ansehen für seine journalistische Integrität, gilt den Trump-Leuten aber als links. Chefredakteur Goldberg war schon in der Vergangenheit von Trump persönlich attackiert worden, weil dem Präsidenten die Berichterstattung seiner Zeitschrift nicht gefiel.
In diese Kerbe schlagen sowohl Hegseth als auch Trump erneut: Hegseth nannte Goldberg "einen betrügerischen und hochgradig diskreditierten sogenannten Journalisten", der es sich zur Aufgabe gemacht habe, "immer wieder mit Falschmeldungen hausieren zu gehen". Trump blies in ein ähnliches Horn: Angesprochen auf den Fall, behauptete er, zum ersten Mal davon zu hören. Eine Meinung hatte er angeblich dennoch. "Ich bin kein Freund von 'The Atlantic'; für mich ist es ein Magazin, das vor dem Aus steht", sagte Trump.
Auch Legislative und Justiz auf Linie
Drohungen wie diese haben Gewicht. Die neue US-Regierung hat seit dem 20. Januar schon mehrere etablierte Medien von Pressekonferenzen im Weißen Haus und vom Zugang zum Pentagon ausgeschlossen. Alternative Medien, oft stramm konservativ bis rechtsextrem, wurden dagegen mit Zugängen aufgewertet. Entsprechend milde bewertet oder gar nicht taucht der Chat-Skandal bislang in Trumps Hofmedien auf.
Vor der Legislative muss der Trump-Truppe ebenfalls nicht bange sein. Der Sprecher der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, machte deutlich, dass die Chat-Affäre keinesfalls Konsequenzen haben werde. Auch im Senat sind die ganz auf Trumps Linie gebrachten Republikaner in der Mehrheit.
Die Justiz macht dieser Regierung erst recht keine Angst mehr. Der US-Präsident höchstpersönlich hortete nach seiner ersten Amtszeit kistenweise hochsensible Regierungsinformationen in seinem Residenz-Bunker Mar-a-Lago. Das Verfahren wurde im vergangenen Sommer von Bezirksrichterin Aileen Cannon eingestellt. Sie war von Trump in dessen erster Amtszeit ernannt worden. Da ist gar nichts mehr zum Lachen, es ist zum Fürchten.