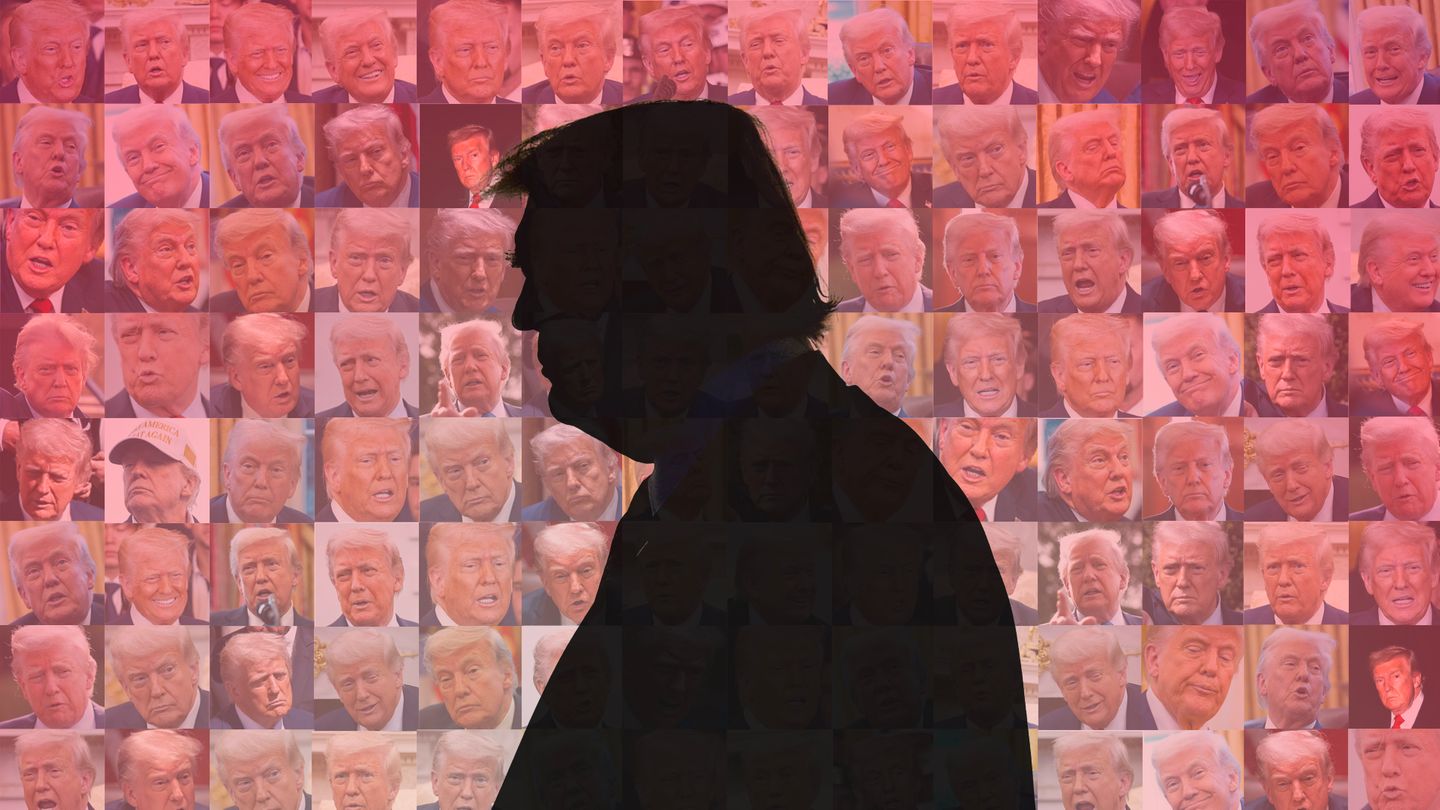Nach 1945 setzen sich viele Nationalsozialisten nach Argentinien ab, um der Strafverfolgung zu entgehen. Nun veröffentlicht Buenos Aires hunderte Akten über die geflüchteten Kriegsverbrecher. Die Dokumente sind im Internet einsehbar.
Argentiniens Regierung hat im Internet Dokumente über Aktivitäten von Nazis veröffentlicht, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das südamerikanische Land geflohen sind. Zu den Akten gehören Unterlagen über NS-Verbrecher wie Josef Mengele und Adolf Eichmann, wie auf der Website des Nationalarchivs zu sehen ist.
Mehr als 1850 Dokumente, die seit 1992 nur im argentinischen Bundesarchiv auf Papier einsehbar waren, sind nun dank "umfangreicher Restaurierungs- und Digitalisierungsarbeiten" online verfügbar, wie die stellvertretende Kabinettsleitung des Innenministeriums mitteilte. Demnach sind die Akten das Ergebnis von Ermittlungen der Auslandsabteilung der Bundespolizei, dem Geheimdienst SIDE und der Nationalgendarmerie, die von den 1950er- bis 1980er-Jahren durchgeführt wurden.
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches versuchte Argentiniens Präsident Juan Domingo Peron, Spezialisten aus Deutschland für die Modernisierung des Landes zu holen. Sie sollten dem Staat nötiges technologisches Wissen vermitteln, um in den Kreis der Industrienationen aufrücken zu können. Auch wollte Buenos Aires dank deutscher Fachleute eine militärische Vormachtstellung in Südamerika erreichen.
Dass mit vielen unbelasteten Deutschen aber auch zahlreiche Kriegsverbrecher kamen, störte den Mussolini-Bewunderer Peron nicht. Im Gegenteil. Der Präsident bildete sogar eine Hilfskommission, um flüchtige Nationalsozialisten sicher von Europa nach Südamerika zu bringen.
Der SS-Obersturmbannführer Eichmann hatte während der NS-Zeit Millionen Juden in Vernichtungslager deportieren lassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchtete er 1948 nach Argentinien, ehe ihn israelische Agenten im Mai 1960 entführten und nach Israel brachten, wo er angeklagt und zum Tode verurteilt wurde. Mengele war als KZ-Arzt für grausamste medizinische Experimente verantwortlich. Er floh 1949 zunächst nach Argentinien und später weiter nach Brasilien, wo er schließlich starb.